
Hitchcock wurde nicht nur zur Marke, sondern zur Briefmarke. Foto: USPS
Alfred Hitchcock (1899-1980) war nicht nur ein Großmeister der Spannung mit Filmen wie „Psycho“, „Der unsichtbare Dritte“, „Die Vögel“ und „Das Fenster zum Hof“. Sondern auch ein begnadeter Selbstdarsteller, der sich zur Marke machte. Eine exzellente Luxemburger Ausstellung widmet sich Hitchcocks Eigen-Inszenierung – wir haben mit dem Kurator und Sammler Paul Lesch gesprochen, zugleich Leiter des „Centre national de l’audiovisuel“ (CNA) in Luxemburg.
Herr Lesch, Ihre Ausstellung „Hitchcock. The Brand“ zeichnet nach, wie Alfred Hitchcock sich selbst zu einer wiedererkennbaren Marke gemacht hat. Wann hat er damit begonnen?
LESCH Das war schon Ende der 1920er seine Strategie. Er wusste, dass er für die Freiheit, die Filme zu machen, die er machen will, vom großen Publikum wahrgenommen werden muss. So hat er sich früh um sein eigenes Marketing gekümmert. In den 1930ern hieß es schon „ein Film von Alfred Hitchcock“ und nicht nur „Regie von Alfred Hitchcock“. Als er nach Hollywood ging, hat er das verstärkt: Da gab es Fotos von ihm auf Anzeigen und Filmplakaten, was es bei keinem anderen Filmemacher gab. Zu dieser Strategie gehören auch seine Kurzauftritte in den eigenen Filmen, immerhin 37 Mal bei 55 Filmen. Das ist ein Spiel mit dem Zuschauer, der Hitchcock suchen muss, und ein glänzender Marketingtrick.
Welche Rolle spielt seine TV-Serie „Alfred Hitchcock presents“, die von 1955-1965 lief?
LESCH Eine sehr große. Er trat vor und nach jeder Episode auf und festigte damit sein Image: das eines jovialen, aber makabren Zeitgenossen, mit einem schwarzen Humor, der auch heute noch funktioniert.
Mitte der 50er Jahre waren Fernsehen und Kino große Rivalen – ungewöhnlich, dass ein Kino-Regisseur sich auch im „kleinen Medium“ Fernsehen gezeigt hat.
LESCH Er war da durchaus ein Vorreiter, er hat die Bedeutung des Fernsehens erkannt. Kollegen haben das Medium lange gemieden, weil sie es als nicht als standesgemäß empfunden haben. Hitchcock hat außerdem viel Presse für sich gemacht, für Interviews auch kleinerer Zeitungen hat er sich immer viel Zeit genommen, weil er wusste, wie wichtig gute Presse ist. Er hat jedes Spielchen gerne mitgespielt.

Sammler, Kurator und Hitchcock-Kenner Paul Lesch (links) und Regisseur Terry Gilliam („Brazil“, „Twelve Monkeys“) in der Luxemburger Ausstellung. Gilliam war beim Luxemburg City Film Fest dabei. Foto: Lesch
Hitchcocks Garderobe bei der Arbeit war sehr klassisch, stets mit dunklem Anzug und Krawatte. War das auch Teil seines Images?
LESCH Nicht nur. Er war wirklich der Meinung, dass dieses klassische Auftreten dazugehört – das hat er auch von seinen Mitarbeitern verlangt. Ich besitze zwar ein paar Fotos von ihm im kurzärmeligen Hemd, aber die sind selten – etwa, wenn er in Marokko drehte, da ging es bei der Hitze eben nicht anders. Diesen Totengräber-Look mochte er einfach.
In seinen Erinnerungen schreibt Regisseur William Friedkin („Der Exorzist“), dass Hitchcock ihn, damals ein Nachwuchsregisseur, im Studio wegen einer fehlenden Krawatte zurechtgewiesen haben soll.
LESCH Ja, das hab ich auch gelesen. Diese jungen Wilden, das New Hollywood der 1970er, das war nicht seine Generation – auch wenn er sich schon dafür interessiert hat, was die gemacht haben. Zugleich war er selber ja immer sehr experimentierfreudig – unter anderem drehte er einen Film wie „Lifeboat“, der nur in einem Rettungsboot spielt, dann „Rope“ ohne erkennbare Schnitt. Etwas ganz Neues war auch, dass der ab den 1950ern in den Trailern seiner Filme aufgetreten ist. Im Trailer zu „Psycho“ sieht man keine einzige Szene aus dem Film, sondern Hitchcock macht eine kleine Führung durch die Kulissen. Sehr originell.

Hitchcock als Albumcover – später zitiert von Eminem. Foto. London Records
Ihre Ausstellung zeigt auch, wie sein öffentliches Bild nach seinem Tod ein Teil der populären Kultur blieb.
LESCH Ja, in der Kunst, in der Werbung etwa und in der Mode: Alexander McQueen hat zwei Kollektionen, die von Hitchcocks Stil beeinflusst sind. Eminem lehnte das Cover seines Album „Music to be murdered by“ an Hitchcock-Optik an. Sehr witzig. Auch andere Künstler, Romane, Comics beziehen sich auf ihn, Hellmuth Karasek hat ein Theaterstück über ihn geschrieben. In einer aktuellen Karikatur des „New Yorker“ bedankt sich Hitchcock beim abgewählten Präsidenten Trump für „wirklich erschreckende Jahre“. Man kennt ihn und seine Rolle als Meister der Spannung heute noch.
Zu Lebzeiten hat er ja auch seinen Namen und sein Gesicht vermarktet, auch in Deutschland etwa bei Büchern wie den „Drei Fragezeichen“. Leicht verdientes Geld?
LESCH Ja. Er wusste, wie man Geld verdient, er hat ja auch gut gelebt – sein Haus in Bel Air war äußerlich nicht spektakulär, aber er hatte einen exzellenten Weinkeller, er hat sich teures Essen aus Europa oder von der Ostküste kommen lassen. Er ist sehr viel gereist mit seiner Frau Alma, die auch bei seiner Arbeit eine zentrale Rolle gespielt hat. Bei den Reisen hatte er Auftritte, um sich bekannt zu machen – ich habe Zeitschriften aus der ganzen Welt dazu, russische, chinesische, türkische. Es gibt mehrere hundert Bücher über ihn, darunter ein Dutzend auf Farsi, die im Iran herauskamen. Außer über Chaplin und Disney sind wohl über keinen Filmemacher so viele Bücher erschienen.

Ein Blick in die Ausstellung. Foto: Mike Zenari
Welche Rolle spielt da das legendäre Buch „Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht“, in dem er im Gespräch mit dem französischen Kollegen François Truffaut seine Filme sehr detailliert erklärt.
LESCH Das Buch hatte eine enorme Wirkung, erst in Frankreich, dann international. Aber man streitet bis heute, ob Hitchcock nicht auch vor Erscheinen dieses Buchs schon als wichtiger Regisseur akzeptiert war. Bevor damalige Kritiker wie Truffaut, Claude Chabrol und Eric Rohmer ihn als „auteur“ bezeichnet haben, hatte er ja schon demonstriert, dass er mehr war als ein brillanter Techniker.
Woher kommt Ihre Faszination für Hitchcock?
LESCH Ende der 1970er, da war ich um die 13, habe ich angefangen, mich mit Kino zu beschäftigen. Damals liefen Hitchcock-Filme im französischen und im deutschen Fernsehen, ich las das Truffaut-Buch – und da wurde mir bewusst, wie Filme gemacht werden, wie viele Entscheidungen ein Regisseur treffen muss – mit Hitchcock hat meine „Cinéphilie“ angefangen. Ich bin dann oft nach Paris gefahren, in viele schöne Filmbuchläden, habe Fotos gekauft, Plakate, Bücher. Mittlerweile habe ich um die 400 Bücher über Hitchcock in meiner Bibliothek.
Haben Sie ein besonderes Schmuckstück in der Sammlung?
LESCH Sehr viel bedeutet mir ein Autogramm. In der Zeitschrift „Hörzu“ standen damals in den 70ern Autogrammadressen – auch die von Hitchcock. Ich schrieb sie an, Wochen später bekam ich Luftpost – es war Hitchcocks Autogramm. Da war ich sehr stolz als Jugendlicher. So gesehen ist diese Ausstellung auch eine Rückkehr in meine Jugend. Ich erinnere mich an die Reisen nach Paris, nach London, ich weiß noch, welche Bücher ich wo gekauft habe. Das alles zusammen ausgestellt zu sehen, ist schon eine Freude.

Plakat zu einem der großen Klassiker. Foto: Universal
Wissen Sie, wie viele Stücke Sie in der Sammlung haben?
LESCH Wenn man alles zusammennimmt, auch Fotos und etwa Streichholzschachteln mit dem Gesicht von Hitchcock, kann ich es nicht mehr zählen.
Wo bewahren sie das alles auf?
LESCH Das ist immer ein Problem – vor allem in meiner Wohnung, auch im CNA. Nach der Ausstellung kommen viele Fotos, die vorher nicht gerahmt waren, gerahmt zu mir zurück. Dann wird es noch enger. Dieses Problem werde ich irgendwie lösen müssen.
Wie sehen Sie Hitchcocks Karriere? Der Konsens ist ja, dass ihm Mitte der 1960er dann doch die Luft ausging, mit schwächeren Filmen wie „Topaz“ und „Der zerrissene Vorhang“.
LESCH „Topaz“ ist keiner meiner Lieblingsfilme, ich bin auch kein Fan von „Marnie“, einem Film, der aber gerade wiederentdeckt wird. „Der zerrissene Vorhang“ ist auch kein guter Film, er hat aber einige gute Szenen – nicht zuletzt den Mord an Wolfgang Kieling. Aber mit seinem vorletzten Film „Frenzy“ hatte Hitchcock dann eine Revanche, es ist einer seiner besten Filme und, wie Peter Bogdanovich es formulierte, der „Film eines jungen Mannes“ – auch wenn Hitchcock damals schon 73 Jahre alt war. Sein letzter Film „Familiengrab“ war dann der erste Film, den ich bei der Erstaufführung im Kino gesehen habe.
Ist heute ein Filmemacher eine eigene Marke in der Art wie Hitchcock?
LESCH Quentin Tarantino – man schaut sich ja einfach „den neuen Tarantino“ an, egal um was es geht, egal wer mitspielt. Auch Tarantino geht sehr clever mit der Presse um, da gibt es schon Parallelen, weniger Filmische, aber was das Eigen-Marketing angeht.
Und Wes Anderson, der ja ein typisches „Wes-Anderson-Image“ kultiviert?
LESCH Er hat sich auch ein bestimmtes Image erschaffen, allerdings arbeitet er für ein ganz bestimmtes, aber auch begrenztes Publikum – Hitchcock hatte immer das große Publikum im Blick.
Hitchcock. The Brand. Bis 10. April, Cercle Cité. Geöffnet täglich von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Termin: Am 30. März, 18.30 Uhr, spricht Paul Lesch (in Französisch) im Auditorium Cité über Hitchcocks kunstvolle Selbstinszenierung.
Infos: www.cerclecite.lu











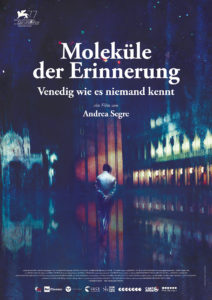









































































Neueste Kommentare