
Elfriede Jelinek in einer alten TV-Sendung, ein Ausschnitt ist auch im Film zusehen. Foto: Plan C
Egal, ob es nun ein Ziel dieser Dokumentation ist oder nicht: Hat man den Film gesehen, möchte man im nächsten Buchladen nach Werken der Schriftstellerin schauen. „ Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen“ ist ein packendes, dichtes Porträt – literarisch, biografisch und politisch, voller Texte und Sprachlust, voller klug montierter Bilder und Szenen. Man ist sofort mittendrin im Thema Jelinek, wenn der Film einen alten TV-Mitschnitt zeigt, in dem die Schriftstellerin die wenige Zeit in einer Literatursendung für Autorinnen kritisiert (50 Minuten für Männer contra zehn für Frauen), dann die Verkündung des Literaturnobelpreises 2004 gezeigt wird und Jelinek aus dem Off kommentiert: „Ich kann da nicht hinfahren“, wegen einer Angststörung. „Rausgehen, das kann ich nicht mehr.“ Darüber, wie weit diese Angststörung, an der sie seit ihrer Jugend leidet, auch weiter befeuert wird vom Hass, der Jelinek in ihrer österreichischen Heimat entgegenschlägt, spekuliert der Film nicht. Das kann man selbst tun. Der Film will nicht psychologisieren.
„Mutters einziges Kind, das in der Spur bleiben soll“
Mit Zitaten und Archivaufnahmen zeichnet Regisseurin Claudia Müller die Jugend Jelineks nach, Jahrgang 1946, ein „Nichtlebendürfen“ – der Vater ist laut Jelinek „verrückt geworden“, die Mutter fördert und überfordert die Tochter in allerlei musischen Disziplinen. Sie dominiert die Tochter, die sie im Film als manchmal „gefährliches Tier“ bezeichnet, durch die sie das Lügen gelernt habe, um sie zu besänftigen, als „Mutters einziges Kind, das in der Spur bleiben soll“.

Elfriede Jelinek in einer Archivszene des Films. Foto: Plan C
Die junge Jelinek „rettet sich in die Sprache“, wie sie sagt, weil das der einzige Bereich gewesen sei, in dem die Mutter sie nicht zur Leistung antrieb. Früh erhält sie Preise, begreift sich als Autorin, die etwas bewegen will, die eine „größere Effektivität im politischen Sinne“ erreichen will – feministisch und als Kritikerin politischer Zustände in ihrer Heimat Österreich, an denen sie leidet. Exemplarisch für sie ist etwa die Schauspielerin Paula Wessely (1907-2000); im NS-Kino war sie ein Star, ab den 1950ern war sie ein Star am Wiener Burgtheater – der Film zeigt einen grausigen Auftritt Wesselys im perfiden Propagandawerk „Heimkehr“ aus dem Jahr 1941.
„Wut und Hass“
Jelineks Kritik unter anderem an Wessely im Stück „Burgtheater“ (1985 nicht in Wien, sondern im fernen Bonn uraufgeführt) ist ein Wendepunkt in der Rezeption der Schriftstellerin, sagt Jelinek selbst. Seitdem habe sie „polarisiert“, das sei, vielleicht meint sie das etwas ironisch, „der Beginn meines Abstiegs“ – in jedem Fall spätestens der Beginn der Anfeindungen gegen sie: als „Nestbeschmutzerin“. Jelinek wird (und bleibt) Hassfigur vieler Konservativer, vor allem männlicher, wegen ihres kritischen Blicks auf Österreich und auf männlich geprägte Strukturen. Ein Ausschnitt zeigt auch eine Szene des seligen „Literarischen Quartetts“ zur Zeit von Marcel Reich-Ranicki. Der wundert sich über so viel „Wut und Hass“ und darüber, dass bei Jelinek „das Sexuelle demontiert“ wird – fast wirkt es, als sorge er sich um das Seelenheil der Autorin.
Interview mit Buchpreisträger Tonio Schachinger
Der Film lässt viel Raum für die Texte Jelineks mit ihrer kunstvollen Sprache und oft einem sehr dunklen Humor. Mal werden die von ihr in alten Mitschnitten gelesen, vor allem aber von Sophie Rois, Martin Wuttke, Maren Kroymann und Sandra Hüller. Das alleine ist schon eine Wonne, während der Film das nicht brav inhaltlich, sondern eher assoziativ illustriert – mit Bildern aus Österreich, ebenso mit prächtigen Bergpanoramen wie mit hässlichen Après-Ski-Momentaufnahmen und Super-8-Aufnahmen aus den 1950ern (Montage: Mechthild Barth).
Nach dem Nobelpreis hat sich Jelinek noch weiter zurückgezogen, auch wenn sie für diesen Film mit der Regisseurin viel Kontakt hatte und ihr 2021 ein Interview gab, das im Film zum Teil verwendet wird. Aber erklären will sie ihre Werke nicht mehr, es sei alles gesagt. Gut, dass es dennoch diesen Film gibt.
Termin: 13.5., 22.15, Arte und ab dann in der Mediathek.
DVD bei Farbfilm Verleih.
„Die Klavierspielerin“ nach Jelinek ist ebenfalls in der Mediathek.
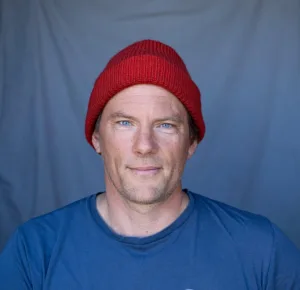


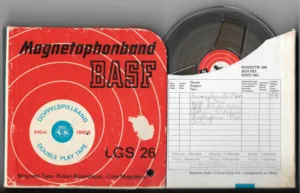

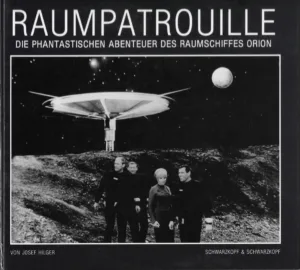

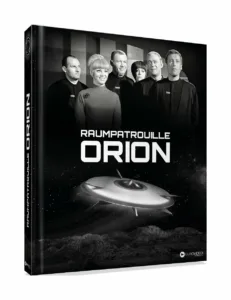









Neueste Kommentare