
Der Schriftsteller Andreas Pflüger. Foto: Stefan Klüter / Suhrkamp
Schriftsteller Andreas Pflüger (66) hat gerade den Deutschen Krimipreis mit „Wie Sterben geht“ gewonnen. Der Roman erzählt von Spionage in den 1980ern, von einer Agentin des Bundesnachrichtendiensts, die in Moskau in Todesgefahr gerät. Bekannt ist Pflüger unter anderem für seine Trilogie über die blinde Polizistin Jenny Aaaron, für den Thriller „Operation Rubikon“ und für seine Drehbücher, unter anderem für 27 „Tatorte“.
In „Wie Sterben geht“ erzählen Sie eine Spionagegeschichte in den 1980ern, in der BRD und in Moskau, vom Kalten Krieg, der droht, zu einem realen zu werden. Was sagt uns diese Handlung über die Zeit von heute – wo sind die Parallelen?
PFLÜGER Als Putins Truppen die Ukraine überfielen, hatte ich schon zwei Monate Recherche in den Roman gesteckt und noch etwa fünf vor mir. Ich habe ernsthaft erwogen, die Arbeit abzubrechen, aber gerade die unfassbaren Parallelen zwischen der Welt vor 40 Jahren und unserer Jetztzeit haben mich bewogen, das Buch nun erst recht zu schreiben. Die damalige Konfrontation des Westens mit der Sowjetunion, auf die Spitze getrieben nach dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan, erinnert auf gespenstische Weise an das Heute. In dem Roman lege ich die Fundamente von Putins Herrschaft frei, die allesamt aus der Sowjetzeit stammen. Aber ganz nebenbei ist es natürlich auch ein spannender Thriller.
Gibt es ein Konzept, wie man Spannung aufbaut? Muss da ein genaues dramaturgisches Konzept stehen, mit Spannungsbögen und regelmäßigem Spektakulären, bevor es an die eigentliche Arbeit des Schreibens geht?
PFLÜGER So habe ich als Drehbuchautor gearbeitet, aber Romane schreibe ich ganz anders. Ich beginne mit einer relativ vagen Grundidee, steige in die Recherche ein und verlasse mich, wenn ich endlich den ersten Satz schreibe, darauf, dass meine Figuren, vor allem natürlich meine Hauptfigur, Vertrauen zu mir fassen und mir ihr Leben erzählen. Mehr oder weniger bin ich nur ihr Chronist, was bedeutet, dass ich immer wieder überrascht werde. Wenn ein Autor nicht über seinen eigenen Text staunen kann, sollte er es lassen. Die Dramaturgie, die bei meinen Romanen gerne hervorgehoben wird, mache ich im Grunde mit einer Hand in der Hosentasche. Ich weiß einfach, wann ich das Tempo anziehen oder rausnehmen muss. Das ist wieder meiner Vergangenheit als Drehbuchautor geschuldet, da verinnerlicht man das, bis es irgendwann Teil der Autoren-DNA geworden ist.

Sie sind in Saarbrücken aufgewachsen – wenn Sie aus Berlin zu Lesungen ins Saarland kommen, gibt es da bestimmte Orte, die Sie dann wieder besuchen?
PFLÜGER Im Grunde bin ich immer ein bisschen beleidigt, wenn es heißt: „im Saarland aufgewachsen“. Ich kam mit drei Monaten nach Fechingen, wo meine Mutter herstammte, und ging mit 22 zum Studium fort. Also bin ich Saarländer, und sobald ich auf der Autobahn die ersten vertrauten Ortsnamen sehe, bin ich dahemm. Mein erster Weg führt mich immer zur Diskonto-Schenke an der Wilhelm-Heinrich-Brücke, dort esse ich die einzig wahre Currywurst; die Berliner Currywurst ist nichts dagegen. Motorradfahren im Bliesgau oder im Krummen Elsass vermisse ich auch, darauf freue ich mich jeden Sommer.
Wie stark hat sich die Stadt oder das Land in Ihrer Wahrnehmung verändert?
PFLÜGER Mein Großvater hat auf dem Halberg am Hochofen gearbeitet, das ist jetzt alles weg. Man spürt schon stark, dass das Saarland deindustrialisiert wurde. Vor zwei Jahren bin ich in Neunkirchen in der Alten Gebläsehalle aufgetreten, da wurde mir das wieder sehr bewusst. Eingeladen hatte mich Anke Birk von „Bücher König“, eine tolle, bemerkenswerte Frau und fast schon eine Freundin. Sie hat mich als Erste zu einer Lesung in die Heimat geholt, das hat mir etwas bedeutet.
Interview mit Autor Thomas Hettche
Sie recherchieren lange für Ihre Romane – aber wie frei darf oder muss man letztlich mit Fakten umgehen?
PFLÜGER Ich recherchiere immer zu viel. Am Ende schafft es nur ein Bruchteil davon in den Text. Aber ich brauche das, damit ich mich in einem Stoff ganz und gar sicher fühle. Historische Fakten verbiege ich nie, ich versuche allerdings, mich erzählerisch haarscharf daran entlang zu bewegen. Ein gutes Beispiel wäre vielleicht der Kanzlerspion Guillaume, der im Roman eine Rolle spielt. Realiter wurde er durch einen Funkspruch des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) enttarnt. Bei mir hat Rem Kukura, meine zweite große Hauptperson, ihn als Agent des Bundesnachrichtendiensts in Moskau ans Messer geliefert. Manchmal öffnet sich in der Wirklichkeit eine Tür zu einer alternativen Welt. Ich bin keiner, der dann schüchtern auf der Schwelle stehenbleibt.
Im Roman heißt es „Dem KGB war es gelungen, die Sowjetunion zum Opfer und die Nato zum Aggressor zu machen.“ Das klingt sehr nach unserer Gegenwart – können Sie das Phänomen des „Putinverstehens“ nachvollziehen?
PFLÜGER Diese Menschen kapieren nicht, dass sie für Putin nur nützliche Idioten sind. Schon in den Achtzigern wurde die Friedensbewegung vom KGB manipuliert, teilweise sogar gesteuert. Für ihre Desinformationskampagnen hatten die Russen ein niedliches Wort kreiert: Maskirowka. Das Geheimdienstgebäude Lubjanka war schon damals nichts anderes als eine Trollfabrik, obwohl der Begriff noch nicht erfunden war. Auch davon erzähle ich in „Wie Sterben geht“.
Im Roman sagt Rem Kukura: „An dem Tag, an dem wir unter der Last unserer Schuld und Lächerlichkeit und Nichtigkeit zusammenbrechen, wird dieses Imperium zu Staub zerfallen wie alle Weltreiche vor ihm.“ Wie groß ist Ihre Hoffnung? In den ersten Tagen nach der russischen Attacke auf die Ukraine hatte man ja noch die leider naive Hoffnung, der Putin-Apparat würde unter Protest gegen den Krieg zusammenstürzen.
PFLÜGER Diese Hoffnung hatte ich nur ganz kurz, jetzt nicht mehr. Putin versteht es geschickt, in seinem Sicherheitsapparat Rivalitäten zu erzeugen, indem er die Zuständigkeiten der Dienste bewusst nicht klar voneinander abgrenzt. Also kämpft dort jeder gegen jeden, und keiner in der Etage unter Putin wird stark genug, einen Putsch zu wagen. Auch das hat er von Chruschtschow, Breschnew, Andropow und Co. gelernt. Putin sieht sich ja gern in deren Nachfolge. So widerwärtig er ist: In diesem Punkt stimme ich ihm zu.
Interview mit Buchpreisträger Tonio Schachinger
Sie setzen die Schrift Ihrer Romane selbst und vermeiden dabei Trennungen – wieso? Ist das ein Spleen oder hat das eine besondere sprachliche Bedeutung und Funktion?
PFLÜGER Meine Romane setze ich in erster Linie, weil ich es kann. Ich nutze das Layout meiner Texte bewusst als stilistisches und dramaturgisches Stilmittel. Oft ist am Ende einer ungeraden Seite ein Spannungsmoment – dann blättert man um und: Tusch! Einen Roman ganz ohne Worttrennungen zu setzen, ist natürlich etwas Besonderes, das war auch für mich eine Premiere. Ehrlich gesagt wüsste ich gar nicht, wer das vor mir schon einmal gemacht hätte. Dadurch war ich gezwungen, mich beim Schreiben auf jede einzelne Zeile zu konzentrieren, immer die beste sprachliche Lösung zu finden. Und dann korrigiert man das natürlich noch zigmal. So bin ich immer tiefer in meinen Text eingedrungen und habe ihn immer besser verstanden.
Sie haben viele Drehbücher geschrieben, auch für „Tatorte“ – was halten Sie von den aktuellen „Tatorten“ aus Saarbrücken? Und würden Sie etwas anders machen, wenn Sie ein Drehbuch für Saarbrücken schreiben würden?
PFLÜGER Ich bin bei beiden Fragen leider überfordert, weil ich in meinem Leben nicht mehr als fünf „Tatorte“ gesehen habe, die nicht von mir waren. Ich wollte von Anfang an einen „Tatort“ so schreiben, wie ich ihn mir vorstelle, und mich nicht zu sehr von anderen beeinflussen lassen. Für die Saarbrücker habe ich ja auch mal einen geschrieben, „Bittere Trauben“, da war Maximilian Brückner noch Kommissar. Ich habe das nicht in guter Erinnerung, aus einer Reihe von Gründen. Aber schmutzige Wäsche zu waschen, ist nicht mein Ding.
Andreas Pflüger: Wie Sterben geht. Suhrkamp, 445 Seiten, 25 Euro.
Informationen und Kontakt: andreaspflueger.de

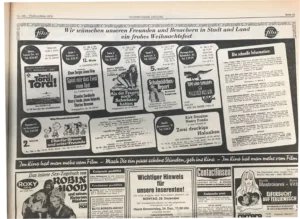






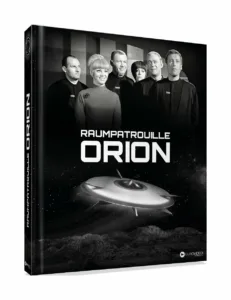



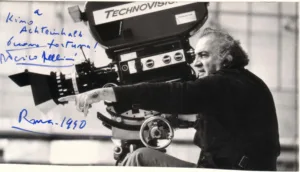


Neueste Kommentare