
Das Plakatmotiv zu „Im Wasser der Seine“. Foto: Netflix
Peinlich ist das schon. Da geißelt der Film – völlig zurecht – in seinen ersten Minuten die Vermüllung der Meere, zeigt die türkisblaue Ex-Schönheit des Nordpazifiks, entstellt von quallengleich dahinschwebenden Kunststofftüten – und dann lässt der Film seine Heldin dramaturgisch unmotiviert gleich zweimal aus der schnöden Plastiktüte eines bekannten Süßwarenherstellers naschen. Nun ist Schleichwerbung ja nichts Neues; aber wenn ein Film einen Naschwerk-Plastiktüten-Riesen an der Öko-Botschaft knabbern lässt, landet die Glaubwürdigkeit in der gelben Tonne – zumal Regisseur Xavier Gens seinen Film vollmundig als „ökologische Parabel“ bezeichnet hat.
Simpel, aber effektiv
Andererseits – Schwamm drüber. Denn die französische Netflix-Produktion „Das Wasser der Seine“ will vor allem ein Thriller sein und fußt dabei auf einer simplen, aber effektiven Prämisse: ein hungriger Hai in Paris. Parbleu! Lilith heißt das Tier, so benannt von der Biologin Sophia (Bérénice Bejo). Sie studiert den Makohai zu Beginn des Films im Pazifik, wo er a) unerwartet schnell wächst und b) in einem Anfall von Heißhunger unter anderem den Ehemann der Forscherin frisst. Der Film lässt da nicht zimperlich einen abgetrennten Arm mit Finger mit Ehering durchs Wasser schweben. Nach einem Zeitsprung von drei Jahren treffen wir Sophia in Paris wieder; mit aktiver Meeresforschung will sie nichts mehr zu tun haben, sondern unterrichtet auf festem Boden über den angeschlagenen Zustand der Meere.
Aktivisten im Altbau
Doch junge Öko-Aktivistinnen und -Aktivisten vom Geheimclub „SOS“ treten an sie heran und führen sie in ihr Hauptquartier, einen Raum, der jede Wohnungsnot in Paris vergessen macht: ein geräumiger Altbau mit reihenweise PCs und einem Beamer, der Szenen aus den Ozeanen an die Wand projiziert. Die Aktivisten wissen, da ihre IT-Expertin (stets mit Wollmütze) am PC es beweist, dass Lilith nicht mehr im Pazifik schwimmt, sondern in der Seine. Warum auch nicht? Sophia ist schnell überzeugt, nicht aber die Wasserbrigade der Polizei und vor allem nicht die Oberbürgermeisterin (wunderbar ölig gespielt von Anne Marivin) – sie will sich einen Massen-Triathlon in der für viel Geld gesäuberten Seine und den damit einhergehenden Image-Gewinn nicht verderben lassen. Denn „Paris ist ein Fest“ verkündet sie. Wenn auch letztendlich, das befürchtet man als Zuschauer, eher für den hungrigen Fisch als für die Schwimmer.

Ein Bild von der Dreharbeiten vor Green Screen. Foto: Netflix
Netflix-Produktion „Leave the world behind“
Wie der Hai es vom Pazifik nach Paris geschafft hat oder wie er mit Süßwasser zurande kommt, ist dem Film nicht so wichtig; ein Darwin-Zitat zu Beginn über die Macht der Anpassung muss reichen; evolutionär setzt das Hai-Weibchen noch einen drauf – Lilith braucht gar keinen männlichen Fisch mehr zur Fortpflanzung. Das Matriarchat mit Flosse also? Jedenfalls muss die wackere Forscherin gleich mehrmals im Film „c’est pas possible“ raunen; überhaupt muss man Bérénice Bejo zu Gute halten, dass vor allem ihre souverän nüchterne Darstellung dem Film hilft, nicht allzu früh zu absurd zu wirken – dem Drehbuch und auch manchen zweitklassigen Computertricks zum Trotze. (Es gibt auch viele gute).
Viel Fischfutter
Langweilig ist der Film dabei nicht, wenn auch weit entfernt von der Schreckensspannung der Fisch-Horror-Urmutter „Der weiße Hai“, auf die als Hommage ein paar Mal angespielt wird. Aber Regisseur Xavier Gens, der 2007 mit dem ruppigen Horrorfilm „Frontière(s)“ bekannt wurde, gelingt eine famose Sequenz klaustrophoben Horrors, wenn er Polizisten und Aktivisten in eine Pariser Katakombe führt und sie dort an einem Becken positioniert, das sich als flüssiges Nest des Hais entpuppt. Beim ausbrechenden Chaos ist es mit der Achtsamkeit und Solidarität der Aktivistinnen und Aktivisten auf der Flucht schnell vorbei – da wird getreten und ins Wasser geschubst, dass es zumindest für den hungrigen Hai eine Freude ist. Überhaupt ist die Haltung des Films zu den Öko-Aktivistinnen und -Aktivistinnen mindestens ambivalent. Sie wollen den Hai lebend ins Meer zurückleiten – doch dafür gehen die Radikalen unter ihnen gerne das Risiko ein, dass Menschen dabei sterben. Keine sympathische Perspektive des Drehbuchs, das uns mit einer gewissen Stammtisch-Perspektive nahelegen will: Die Politik (Bürgermeisterin) ist verlogen; die Aktivisten sind fanatisch; und am Ende muss es die Polizei richten, zusammen mit einer Biologin, die mittlerweile von „Ausrottung“ spricht. „Der Fisch muss weg!“

Begegnung im Pazifik der Plastiktüten. Foto: Netflix
Ideologisch könnte einem das beim Zuschauen nun aufstoßen wie ein altgewordener Heringssalat – aber der Film lenkt im Finale mit einiger Rasanz ab, wobei am Ende Logik und Physik sozusagen ins Wasser fallen. Man mag sich da herzhaft am Kopf kratzen, aber spektakulär sehen die Schlussbilder schon aus. Und um mehr geht es diesem filmischen FishMac wohl auch nicht.
Aktuell bei Netflix.











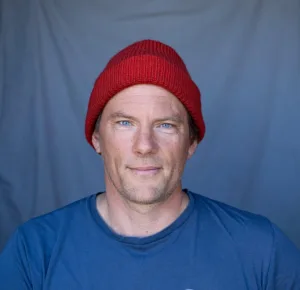







Neueste Kommentare