
Ein klassisches Foto (von 1989): Evelyn Hamann und Loriot auf dem Gründerzeitsofa. Foto: dpa
Weihnachten bei der Familie Hoppenstedt, der Streit in der Badewanne zwischen Herrn Müller-Lüdenscheidt und Dr. Klöbner, die Nudel an der Oberlippe bei einer versuchten Liebeserklärung („Sagen Sie jetzt nichts!“): Solche Szenen von Loriot sind ebenso humoristisches Kulturerbe wie Sätze à la „Ich möchte nur hier sitzen!“, „Früher war mehr Lametta“, „Ein Klavier, ein Klavier“ und „Ach was!“. Über das Werk von Vicco von Bülow (1923-2011), der am 12. November 100 Jahre alt geworden wäre, hat der Kulturwissenschaftler Wieland Schwanebeck ein vergnügliches Buch geschrieben. Wir haben mit Schwanebeck gesprochen.
Ihr Buch bietet nebenbei ein Rezept zum legendären Kosakenzipfel – jener Köstlichkeit, die bei Loriot zwischen den Familien Pröhl und Hoppenstedt einen bitteren Streit auslöst, an dessen Ende Beschimpfungen wie „Jodelschnepfe“ und „Winselstute“ stehen. Haben Sie das Rezept schon mal nachgebacken?
SCHWANEBECK Leider nein – der Mokkatrüffel ist ja ein unverhandelbarer Bestandteil, und dem Geschmack von Mokka kann ich nichts abgewinnen. Ich hätte mich eher für die Crème Caramel entschieden, die von den Damen bestellt wird.
Gibt es überhaupt ein definitives Rezept für den Kosakenzipfel?
SCHWANEBECK Das Rezept, das wir im Buch abdrucken durften, stammt von dem Physiker Thomas Vilgis, und es steht meines Wissens nicht in Konkurrenz zu anderen Zubereitungsvorschlägen. Übrigens ist auch der Weinklassiker „Oberföhringer Vogelspinne“ erst ein paar Jahrzehnte nach dem entsprechenden Loriot-Sketch gekeltert worden.

Der Kulturwissenschaftler Wieland Schwanebeck – bei Reclam hat er auch einen sehr vergnüglichen Band über James Bond veröffentlicht.
Was am „Kosakenzipfel“-Sketch ist besonders typisch für Loriot? Die schnell bröckelnde Fassade der bürgerlichen Höflichkeit? Die Schwierigkeit der Kommunikation?
SCHWANEBECK Ja, das ist das gute, alte Freud-Argument vom dünnen Schleier der Zivilisation. Die meisten Loriot-Nummern spielen im gutbürgerlichen Milieu, man geht in die Oper oder zur Dichterlesung, man putzt sich heraus und repräsentiert – und dann braucht es manchmal nur einen kleinen Stupser, damit diese Fassade kaputtgeht. Das umständlich angebotene „Du“ wird wieder zurückgenommen, der Herr Direktor lässt den Casanova raus, die großbürgerliche Elite kriegt sich in die Haare, weil die Gummi-Ente nicht mit in die Badewanne darf.
Loriot starb 2011, seine beiden Kinofilme sind über 30 Jahre alt – wieso ist sich seine Popularität derart stabil?
SCHWANEBECK Da gibt es natürlich umfangreiche soziologische und kulturhistorische Erklärungen – Loriot blickt ganz tief in die deutsche Seele, Loriot ist unser aller Psychoanalytiker. Ich finde eine wesentlich knappere Erklärung viel einleuchtender: Das Material ist einfach sagenhaft gut, und es ist handwerklich fabelhaft umgesetzt. Deswegen müssen wir auch keine langen Fußnoten studieren, aus denen hervorgeht, wieso die Menschen das vor ein paar Jahrzehnten komisch fanden – wir lachen ja selber immer noch drüber, Erwachsene genauso wie die Kinder, die den ganzen Zitatenschatz weitergereicht bekommen. Wenn das Mini-Atomkraftwerk am Heiligabend ein Loch in den Fußboden sprengt, ist das immer noch genauso lustig wie ein Stunt von Buster Keaton oder ein Wortwitz von Shakespeare.
Interview über Alfred Hitchcocks Selbstinszenierung
Vieles bei Loriot ist zeitlos – aber alles? Was halten Sie für schlecht gealtert?
SCHWANEBECK Über etwas leichtfertigen Sexismus hier und da kann man streiten. Loriot hat in seiner ersten Sendung „Cartoon“ zum Beispiel als einer der Ersten nackte Frauen im Fernsehen gezeigt. Das sind aber eher Irritationsmomente als Schlüpfrigkeiten. Es gibt ein paar Ausrutscher bei seinen frühen Karikaturen, die heute ein bisschen altväterlich wirken – Politessen, die sich lieber schminken, statt für Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen. Aber die hat Loriot zum Teil schon selbst von späteren Wiederveröffentlichungen ausgenommen.
Bedeutet der Konsens der Beliebtheit, dass Loriots Komik und Kritik niemandem wirklich wehgetan hat? Und falls ja – wäre das überhaupt ein Argument gegen ihn?
SCHWANEBECK Humoristen und Satiriker müssen es sicher nicht allen Recht machen, und das hat Loriot auch nicht. Aber er stößt auch niemanden direkt vor den Kopf. Und da bei ihm eigentlich alle Vertreter des politischen Spektrums eins übergebraten bekommen, hat am Ende auch niemand Grund, beleidigt zu sein. Seine Satire zielt auf allgemeinmenschliche Schwächen, wie die Satire von Wilhelm Busch, oder sie zeigt, wie uns unsere Institutionen, unsere Benimmregeln und unsere Fachjargons über den Kopf wachsen. Loriot kann auch böse sein, zum Beispiel in seinen frühesten Fernsehsendungen – aber die sind nicht so dauerpräsent wie die späteren Sketche, die in der bürgerlichen Wohnstube spielen.
Wird Loriot für harmloser gehalten, als er es war? Hat er seine Botschaften gut getarnt? Seine beiden Kinofilme „Ödipussi“ und „Pappa ante Portas“ etwa sind bei aller Komik auch Filme, die unter anderem von Beklemmung und Einsamkeit erzählen, auch vom gelegentlichen Horror des Alltags.
SCHWANEBECK Das finde ich auch. „Ödipussi“ hat ja nicht nur aufgrund seines Titels Anleihen in der Tragödie. Ich finde es ganz bezeichnend, dass er in „Pappa ante Portas“ die subjektive Stalker-Kamera aus dem Horrorfilmgenre verwendet, um das Eindringen des Familienvaters in den häuslichen Wohnraum zu zeigen. Beim Wiederschauen war ich auch überrascht, wie sehr gerade die Kinofilme an die Schmerzgrenze gehen. Viel davon geht schon in Richtung des in den letzten Jahren boomenden Fremdscham-Humors.
Lost Place: Ein vergessenes Waldschwimmbad in der Eifel
Trägt zu dieser Tarnung auch Loriots gediegenes Bildschirm-Image bei – der Bildungsbürger auf dem Sofa?
SCHWANEBECK Dieses Bild hat sich natürlich eingebrannt – der feine Herr auf dem Sofa, der niemals aus der Rolle fällt und nie die Beherrschung verliert. Aber in den Sketchen ist Loriot umso ausgelassener und macht sogar richtigen Klamauk. Vor falschen Zähnen, schlechten Toupets und angeklebten Nasen hatte er keine Berührungsängste, und vor groteskem oder schwarzem Humor erst recht nicht.
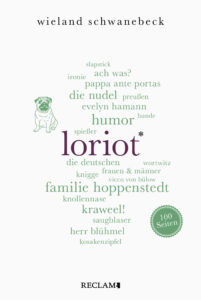
Wie verwunderlich ist es, dass er Sätze wie „Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti bloß noch saugen kann“ plus „wo Mutti sonst nur blasen kann“ im Hauptabendprogramm unter bekam – und dann noch in einer Weihnachtsepisode…
SCHWANEBECK … die sogar noch immer alljährlich wiederholt wird und bei der sich Große wie Kleine vor dem Fernseher versammeln. Vielleicht passt es ja gerade zum Anlass, dass auch die beliebteste Weihnachtssendung ein wenig über die Stränge schlägt. Weihnachten ist ja ein sehr karnevalhaftes, körperbetontes Fest, man isst und trinkt mehr, als man sich im Alltag zumuten würde. Warum soll nicht auch der Humor da ein bisschen unter die Gürtellinie zielen dürfen?
Hatte er also auch Freude an der deftigen Zote, nicht nur am feinsinnigen Witz für und über Bildungsbürger?
SCHWANEBECK Absolut, Loriot hat die Zote privat sehr geschätzt und auch immer wieder selbst darauf zurückgegriffen. Allein die Weihnachtsfolge bietet ja noch viele andere Beispiele – da streiten die beiden Herren darum, wer das größte Stück vom (Kosaken-)Zipfel abkriegt, und Opa Hoppenstedt verweigert hartnäckig die Aussage, ob sein Enkelkind ein „Zipfelchen“ hat oder nicht. Ich halte nichts davon, Loriot nur auf seine feinsinnigen Dialoge zu beschränken. Es gibt ausgelassene, derbe Nummern von ihm, und sogar Slapstick.
Ein Hauch Loriot: der Kinofilm „Da kommt noch was“
Auf wen hatten es seine Satiren eher abgesehen – auf das sogenannte Kleinbürgertum oder den klassischen, gerne selbstgefälligen Bildungsbürger?
SCHWANEBECK Würde ich gar nicht unbedingt gegeneinander ausspielen. Kleinbürgerlichkeit bezeichnet ja vor allem eine etwas kurzsichtige Haltung, eine Engstirnigkeit und Rückwärtsgewandtheit, und die Unfähigkeit, mit der Zeit zu gehen. Das schließt bildungsbürgerliche Ambitionen nicht aus, aber es fehlt eben an Reflexionsfähigkeit. Und sobald der Mensch sich selbst und seine Gewohnheiten nicht mehr hinterfragt, handelt er fremdbestimmt – und wird zum potenziellen Lachobjekt. Die beiden Loriot-Figuren, die sich im Flugzeug gegenseitig Rilke zitieren, während sie sich völlig mit dem Essen bekleckern, geben sich zwar bildungsbürgerlich aus, aber als eingepferchte Passagiere stellen sie eben auch Kleinbürgerlichkeit aus.
Es ist reine Spekulation – aber wie hätte sich Loriots Arbeit und Karriere entwickelt, wenn er nicht Evelyn Hamann engagiert hätte?
SCHWANEBECK Ich glaube, die Fernseharbeiten hätten sich nicht wesentlich unterschieden – Loriot schrieb und inszenierte sein Material ja ohnehin im Alleingang, spielte den Schauspielern zum Teil sogar vor, wie sie es umsetzen sollen. Aber mit Evelyn Hamann ist eine so vertrauensvolle Arbeitsbeziehung herangewachsen, dass die beiden Kinofilme letztlich auch ihre Handschrift tragen. Renate Lohse in „Pappa ante Portas“ ist, glaube ich, die dreidimensionalste Figur im ganzen Werk von Loriot – und ist ganz sicher für Evelyn Hamann geschrieben worden.
Loriot war drei Jahre lang Soldat in Russland, sein jüngerer Bruder ist im Krieg umgekommen – inwieweit hat er sich in seiner Kunst mit Krieg und Militarismus beschäftigt?
SCHWANEBECK Loriot hat erst spät über seine eigenen Erlebnisse im Krieg und über seine Erinnerungen an die Nazi-Zeit gesprochen, aber ein Verdränger war er nicht. In seinen Zeichnungen werden ganz oft Uniformgehabe und Kriegstreiberei auf die Schippe genommen, etwa zur Zeit der Flower-Power-Bewegung. Ein Hippie war Loriot deswegen aber nicht, schon weil er Preuße aus Überzeugung war.
Antike Serie „Die Journalistin“
Sehen Sie aktuell hiesige Komiker oder Komikerinnen in seiner Tradition – oder in seinem Geist?
SCHWANEBECK Ja, Loriot hat viele Spuren in der Sketch-Comedy und in der Sitcom hinterlassen. Das ist natürlich nicht allein sein Vermächtnis. Die Frage des richtigen Benimms in Situationen, die allen Beteiligten allmählich entgleiten, hat vor Loriot schon eine große Rolle in der Komik gespielt und tut es immer noch – aber man sieht das in Deutschland dann eben automatisch durch die Loriot-Brille. Ich denke da an Bastian Pastewkas Sitcom oder die beliebten Boulevardstoffe, die es manchmal auch ins Kino schaffen, wie zum Beispiel „Das perfekte Geheimnis“. Auch da beginnt es so gesittet wie beim Kosakenzipfel-Dinner, aber am Ende liegen die Zimmer in Schutt und Asche, und die Beziehungen sind im Eimer.
Hätte er heute als junger Humorist überhaupt Chancen, im Fernsehen unterzukommen?
SCHWANEBECK Seine Qualität würde sich durchsetzen, das glaube ich schon. Die Frage wäre wohl eher, ob jemand von den Fernsehanstalten noch einmal vergleichbare Freiheiten und Gestaltungsspielraum bekäme, um ohne größere Einmischung nach seinen Vorstellungen zu drehen. Außerdem ist Loriot, der ja in den 1920er-Jahren zur Welt kam und den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, so sehr ein Produkt seiner Zeit, vor allem der Adenauer-Jahre, dass man sich kaum vorstellen kann, wie jemand Vergleichbares heute an den Start geht.
„Buba“ mit Bjarne Mädel
Er selbst soll ja einst einen Sketch von den britischen Kollegen von Monty Python geklaut haben…
SCHWANEBECK Monty Python waren es nicht, aber in der Tat gibt es einen frühen Sketch von John Cleese, noch aus den Zeiten vor Monty Python, den Loriot – sagen wir mal – paraphrasiert zu haben scheint. Bei Cleese interviewt ein Fernsehreporter einen Versicherungsvertreter, im Glauben, er sitze einem Tiefseetaucher gegenüber – Loriot hat daraus den „Astronauten“ gemacht. Vielleicht ist es auch ein Fall von Kryptomnesie, so nennt man die unbewusste Übernahme einer Idee. Er hatte es sicher nicht nötig, zu klauen – auch nicht von Monty Python, denen er mit ein paar seiner Einfälle sogar voraus gewesen ist.
Sie haben vor dem Band über Loriot ein Buch über James Bond veröffentlicht. Gibt es da Parallelen?
SCHWANEBECK Ja, eindeutig. James Bond hat 1983 „Octopussy“ ins Kino gebracht, Loriot ein paar Jahre später „Ödipussi“ – das kann in meinen Augen kein Zufall sein.
Eine nahezu unvermeidliche Frage zum Schluss – welcher ist Ihr liebster Loriot-Moment?
SCHWANEBECK Einerseits mag ich sehr die Momente, in denen uns Loriot im Alltag überfällt – neulich sagte jemand in meinem Beisein, als übers Wetter geplaudert wurde, den Satz: „Man muss ja auch an die Landwirtschaft denken“, und ich war mir nicht sicher, ob das ein bewusstes Loriot-Zitat war. Ansonsten halte ich den in „Pappa ante Portas“ vorgetragenen Vierzeiler „Melusine“ mit „Kraweel! Kraweel!“ für den Höhepunkt der modernen Lyrik und liebe die besonders albernen Stellen bei Loriot, weil das Herumalbern uns Deutschen manchmal so schwerfällt. Wir sind halt leider Gottes ein Volk von Witze-Erzählern. Loriot als Weinvertreter, der sich im Wohnzimmer der Hoppenstedts an seinem eigenen Sortiment betrinkt – das scheint mir schwer zu toppen.
Wieland Schwanebeck: Loriot.
Erschienen bei Reclam, 100 Seiten, 10 Euro.









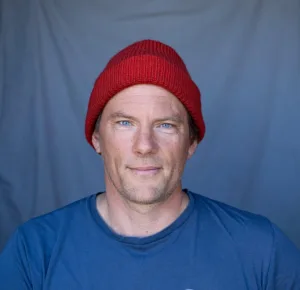



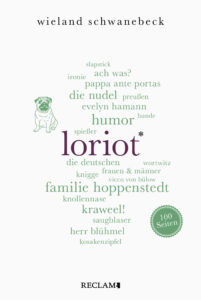





Neueste Kommentare