
Albert Speer und Adolf Hitler. Foto: Salzgeber
Eben noch sind wir zu Hause bei Albert Speer im gemütlichen Heidelberger Wohnzimmer, der Bernhardiner nimmt einen Keks vom Tisch – und einige Filmbilder später sind wir in einem Konzentrationslager, mit dem „Arbeit macht frei“-Schild, mit gequälten Menschen, mit Tod. „Speer goes to Hollywood“ ist ein Film der herben Kontraste: zwischen Vergangenheit und Gegenwart, vor allem aber zwischen Dichtung und Wahrheit.
„Die Geschichte der Kriegsberichterstattung“ von Marcel Ophüls
Die Basis der Dokumentation ist eine Idee Hollywoods. Anfang der 1970er will das Paramount-Studio aus dem ersten Erinnerungsband Albert Speers (1905-1981) einen Kinofilm machen. Speer, als Reichsminister für Bewaffnung und Munition Mitglied der NS-Elite, wurde als einer der wenigen Nazi-Größen in Nürnberg nicht zum Tode verurteilt, sondern zu 20 Jahren Gefängnis. Nach seiner Entlassung 1966 wurde er zum Medienstar. Seine Erinnerungsbände verkauften sich millionenfach, er gab sich in internationalen Interviews reumütig, sprach von „Jahren voller Irrtümer“ und schaffte das Unglaubliche: Obwohl einst einer der mächtigsten Nationalsozialisten, verbreitete er das Bild eines Mannes, der verblendet war und irgendwie die Treppe der Macht hinaufgefallen ist – und vom Holocaust wollte er nichts gewusst haben.
Ein Spielfilm wie ein Van Gogh?
Diese Biografie will Hollywood 1972 verfilmen und schickt den jungen Autor Andrew Birkin (später schrieb er das Skript zu „Der Name der Rose“) zu Speer nach Heidelberg. Dort verbringt Birkin den Winter 1971/72, spricht lange mit Speer, es entstehen über 40 Stunden Tonaufnahmen. Diese sind die Basis für „Speer goes to Hollywood“. Regisseurin Vanessa Lapa illustriert die Tonspur mit historischen Bildern und Szenen, vom Berlin der 1930er über Momente der Nürnberger Prozesse bis zu späten TV-Auftritten Speers. Das Ergebnis ist eine packende Dokumentation. Auf eine Ebene verfolgt man die Gespräche zwischen Birkin und Speer, bei denen der Befragte ebenso Charme zeigt wie eine gewisse Überheblichkeit: Der geplante Spielfilm solle, sagt er, weniger einer Fotografie ähneln denn einem Gemälde, einem Van Gogh – mindestens.

Die Regisseurin Vanessa Lapa
Auf einer zweiten Ebene zeichnet die Doku Speers Karriere chronologisch nach. Als Elite-Nazi und dann, bei den Prozessen in Nürnberg, als begnadeter Jongleur mit Halbwahrheiten. Da gibt er einiges zu, ist sogar stolz darauf, dass er zeitweise 14 Millionen Zwangsarbeiter für die Kriegsindustrie benutzen konnte; von deren Leiden und Sterben will er aber wenig bis nichts gewusst haben. Beim Prozess mit der Brutalität unter anderem in den Kruppschen Stahlwerken konfrontiert, sagt Speer, das halte er „für ziemlich übertrieben“. Und er sei doch für „jede Arbeitskraft dankbar gewesen“.
„Er erscheint einfach wie ein Träumer, der gerne Dinge baut. Sei vorsichtig!“
Die Gespräche zwischen Speer und Birkin sind auch ein Kräftemessen – auf der einen Seite ein Mann, der sein meisterlich geschaffenes Bild des geläuterten, oft unwissenden Mitläufers nicht von einem vielleicht zu kritischen Film beschädigt sehen will; auf der anderen Seite ein Autor, der spürbare Zweifel hat an manchen von Speers Aussagen, aber auch einen zugkräftigen Film schreiben soll. Sein Wunsch: Das Publikum solle sich sofort mit Speer identifizieren. Doch inwieweit muss er dann himmelschreiende Passagen Speers außen vor lassen wie etwa über seine Abneigung gegen „neureiche Juden“? Da habe Speer immer „Ekel“ verspürt – aber der sei „nicht antisemitisch“ gewesen. Die Reaktion auf Birkins ersten Drehbuchentwurf ist ein Desaster: Am Telefon wirft ihm Regisseur Carol Reed („Der dritte Mann“), dem Birkin den Entwurf geschickt hat, vor, das alles sei verzerrt und beschönigend. „Er erscheint einfach wie ein Träumer, der gerne Dinge baut. Sei vorsichtig!“.
Aktuelle Kritik seitens Autor Andrew Birkin
„Speer goes to Hollywood“ ist als Blick auf einen Wahrheitsverdreher, Relativierer und Herausreder faszinierend, filmisch aber nicht ganz ohne Macken. Dass die zu hörenden Gespräche nicht die Originale sind, sondern von Schauspielern neu aufgenommen wurden, ist nicht ideal, die Regisseurin verweist aber auf die schlechte technische Qualität der 50 Jahre alten Aufnahmen. Autor Andrew Birkin, heute 76, hat jüngst allerdings Ungenauigkeiten kritisiert: Die antisemitische „Neureichen“-Passage stamme aus einem anderen Interview Speers, ihm gegenüber habe er das nie gesagt, sonst hätte Birkin darauf reagiert.

Albert Speer 1966 nach 20 Jahren Haft. Foto: Salzgeber
Auch sei der Film nach seinem Drehbuch letztlich nicht gedreht worden, nicht weil Paramount das Interesse verloren habe, wie „Speer goes to Hollywood“ nahelegt, sondern weil Speers Verleger Wolf Siedler sich an einer Passage gestört und deshalb die Option auf die Verfilmungsrechte nicht verlängerte habe: Der Film wollte Speer als Augenzeuge bei Heinrich Himmlers berüchtigter „Posener Rede“ im Oktober 1943 zeigen, in der der SS-Reichsführer vom geplanten Massenmord am jüdischen Volk gesprochen hatte. Speer habe laut Birkin stets betont, bei der Rede nicht dabei gewesen zu sein – es ihm überraschenderweise aber überlassen, die Szene dennoch so im Drehbuch zu belassen.
Eine DVD und eine digitale Fassung soll demnächst bei Salzgeber erscheinen.

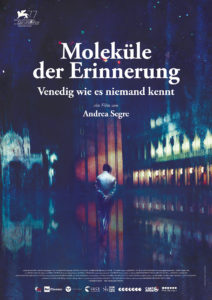


Neueste Kommentare