
Ist es ein „sehr guter“ Film im strengen Sinne? Wohl nicht – aber ein auf seine eigene Weise faszinierender. 1967 soll „Die Schlangengrube und das Pendel“, das ist der Plan, eine abgerissene Tradition in Deutschland wiederbeleben: die des fantastischen Films, des Gruselkinos, des Horrors – Jahrzehnte nach Filmen wie „Nosferatu“, „Der Golem“ oder „Das Kabinett des Dr. Caligari“. Die Idee lag Mitte der 1960er auf der Hand: In den USA füllt Günstig-Filmer Roger Corman mit seinen kunstnebelumflorten Edgar-Allan-Poe-Adaptionen wie „Lebendig begraben“ die Kinos; in Italien dreht Mario Bava mit kleinem Budget und großen Ideen prächtige Schauerfilme wie „Die drei Gesichter der Furcht“. Und in England produziert die Firma Hammer bunte und sehr stilvolle Gruselwerke wie „Dracula“, „Frankensteins Fluch“ oder „Der Hund von Baskerville“ – gerne mit Christopher Lee und Peter Cushing.
Und In Deutschland? Da wabert zumindest ein wenig Grusel durch die Edgar-Wallace-Verfilmungen von Produzent Horst Wendlandt (und durch die „Dr. Mabuse“-Filme von Wendlandts früherem Chef und ewigem Konkurrenten Artur „Atze“ Brauner). Wendland wird Anfang 1967 vom Misserfolg seines Films „Winnetou und sein Freund Old Firehand“ überrascht – seinen Karl-May-Filmen scheint die Luft auszugehen. Wendlandt plant um – warum nicht eine neue Welle lostreten mit veritablen Gruselfilmen, mit Seitenblick auf Corman, Bava und Hammer? Und mit bewährten Mimen, mit denen Wendlandt ohnehin noch einen Vertrag für einen hastig abgesagten May-Film hat: Lex Barker, unvergesslich als Old Shatterhand, und Karin Dor, die gerade ihre Rolle als mörderische Helga Brandt im James-Bond-Film „Man lebt nur zweimal“ abgedreht hat. Christopher Lee, damals der amtierende Dracula der „Hammer“-Studios, ist dann sozusagen die Kirsche auf dem Gruselkuchen.
Und so beginnen am 16. Mai 1967 die Dreharbeiten zu „Die Schlangengrube und das Pendel“ (unter den Arbeitstiteln „Die Wassergrube und das Pendel“ und „Schloss Schreckenstein“, was ein bisschen wie ein Kinderbuch klingt). Regie führt Harald Reinl, Heimatfilm-, Wallace- und May-erfahren beziehungsweise „ein deutscher Spitzenregisseur“, wie der Sprecher des alten Filmtrailers im Bonusmaterial wunderbar ehrfürchtig intoniert (wobei Reinl Österreicher ist). Gedreht wird bei Detmold im Teutoburger Wald, im Isartal und in Rothenburg ob der Tauber. Im Oktober kommt der Film mit vielen Kopien ins Kino, doch der Erfolg ist überschaubar – „die neue Welle“, von der mehrere zeitgenössische TV-Berichte im Bonusmaterial sprechen, hat schon beim ersten Film ausgeplätschert. Ein Jammer. Was hätte aus diesem seriellen Teutonen-Grusel werden können?

„Die Schlangengrube und das Pendel“ erzählt von einem schreckenerregenden Grafen namens Regula, dem im Prolog des Films, der 1806 spielt, der Garaus gemacht wird. Kein Wunder. Da in seinem Schloss 12 Jungfrauen grausig zu Tode gekommen sind, hält die Justiz eine Enthauptung für zu milde, so dass er auf dem Markplatz gevierteilt wird. 35 Jahre später erhalten ein Anwalt (Lex Barker) und eine junge Baronesse (Karin Dor) mysteriöse briefliche Einladungen, das Schloss des Grafen im „Sandertal im Mittelland“ zu besuchen. Schon die Kutschenreise dorthin ist ein Abenteuer, mit nebelverhangenen Wegen, Leichen, die von Bäumen baumeln, und einem verständlicherweise entnervten Kutscher, gespielt von Dieter Eppler, der übrigens später, zwischen 1970 und 1973, Saarbrücker „Tatort“-Kommissar war.
Angekommen im Schloss – sehr atmosphärische Studiobauten mit leibhaftigen Skorpionen, Spinnen und auch Geiern – erleben sie dann gar Schreckliches. Der tote Graf Regula feiert kurzfristige Auferstehung, ausgerechnet am Karfreitag, denn er steht vor einem wissenschaftlichen Durchbruch: Aus dem Blut der 12 hat er einst eine Essenz des ewigen Lebens destilliert, wie genau, das lässt er im Dunkeln, er erklärt nur lapidar: „Ich will nicht ins Detail gehen“ (man hätte es ja gerne erfahren). Die Essenz wirkt aber erst wirklich, wenn er auch Jungfrau Nummer 13 verarbeitet hat – die Baronesse. Aber das kann und will ihr schneidiger Begleiter in Gestalt Lex Barkers nicht zulassen.
Dass der Film damals die Kinokassen nicht erbeben ließ – man kann es nachvollziehen. Der erste Teil, sieht man von der Vierteilung ab, die der Film geschmackvoll (und der FSK 12-Freigabe geschuldet) als Zeichnung eines Bänkelsängers darstellt, ist sehr gemächlich, bevor es im Schloss (gedreht in den Ateliers der Münchner Bavaria) dann sehr atmosphärisch und auch spannend wird: mit blubbernden Labor-Töpfchen, einem gläsernen Sarkophag und einem Gang, der mit hunderten von Totenköpfen bestückt ist. Insgesamt ist das Ganze weniger strammer Horror denn wohlige Schauerromantik, auf die man sich einlassen muss. Es fallen ehrfürchtig deklamierte Sätze wie „In mondlosen Nächten feiert der Teufel dort Feste“ (gemeint ist das Schloss des Grafen), über die man kichern kann oder die man gruselnd auf sich wirken lassen kann. Eine gewisse ernste Naivität besitzt der Film, wie auch die Winnetou-Filme von Regisseur Reinl. Man kann nur darüber spekulieren, wie der Film geworden wäre, hätte etwa Alfred Vohrer den Film inszeniert, neben Reinl der zweite Stammregisseur der Edgar-Wallace-Filme und eher ein Mann des extremen Effekts und des schwarzen Humors als Reinl.

Ein großer Trumpf des Films ist die Musik von Peter Thomas, nicht so grell wie manche seiner Wallace-Kompositionen, sehr atmosphärisch, teilweise mit Orgelklängen – und im Finale, wenn das Pendel über Lex Barkers Heldenbrust hin und her schwingt, hat das fast etwas von Minimal Music. Thomas‘ Musik ist auf CD beim Deluxe Mediabook enthalten, soll außerdem auf Vinyl und digital erscheinen – es lohnt sich.

Trotz mancher Macken: Der Film ist ein sympathisches Kuriosum des deutschen Kinos, ein „Was hätte daraus werden können“ mit viel Charme und Atmosphäre. Wie gut, dass der Film, der vor 15 Jahren erstmals erschien (bei e-m-s), nun hervorragend restauriert vorliegt, mit viel Bonusmaterial.
Die beiden Editionen, erschienen bei UCM.ONE:
MEDIABOOK
1 DVD mit dem Film und eine Blu-ray mit dem Film, plus Audiokommentar (Gerd Naumann, Christopher Klaese, Matthias Künnecke). Außerdem: Der Trailer von einst, 3.20 Minuten. Zitate des dramatischen Sprechers: „Eine romantische Gruselgeschichte“. „Aus dem Reich der Schatten greifen blutgierige Dämonen nach den Lebenden.“ „Das neue Meisterwerk eines deutschen Spitzenregisseurs.“ „Dieser Film gibt ihnen ein ganz neues Gruselgefühl.“
Neuer Teaser, 1.10 Minuten
Slideshow der Film-Rekonstruktion mit Beispiel-Bildern und -Szenen, 8.22 Minuten.
DELUXE MEDIABOOK
Wie das Mediabook, dazu CD mit der Musik von Peter Thomas auf CD und einer weiteren Bonus DVD:
„Ein Grusical wird gedreht.“ WDR-Bericht von 1967, 2.48 Minuten, schwarzweiß. Sehr flott zu Peter-Thomas-Musik montiert. „Der erste deutsche Horrorfilm der neuen Welle.“ (…) „unter der Regie von Dr. Harald Reinl“.
„Neues vom Film“, ZDF 1967 4.02 Minuten, schwarzweiß. „Harald Reinl legt den Grundstein zu einer neuen Kinowelle“, heißt es hoffungsvoll im Film. Reinl sagt, er hab die Poe-Vorlage „bereichert“. Dor erklärt, in Krimis ist man als Figur aktiver, im Horrorfilm eher passiv.
Ufa Wochenschau 1967, 1.28 Minuten. „Erstmals nach dem Kriege versucht ein deutsches Team Anschluss an die Horrorwelle zu finden. Dazu Interviewsätze identisch zu „Neues vom Film“.
Ein Interview mit Karin Dor aus der „Drehscheibe“ des ZDF von 1970. 4.01 Minuten. Interessantes Interview, Dor spricht vom Rollenmangel für sie in Deutschland. „Es gibt für mich hier nichts zu tun. Die Rollen sind einfach nicht vorhanden.“ Und: „Man hat zu 90 Prozent im deutschen Film nichts mehr verloren, wenn man nicht mehr 12 ist und nicht bereit ist, nackt über die Leinwand zu hüpfen.“ In den USA sei man noch „unberührt von der Nacktwelle.“ Und: „Ich kann es mir nicht leisten, TV-Filme zu drehen. Dann muss ich schon einen Film drehen.“
Vergleich der Drehorte damals und heute in Rothenburg ob der Tauber, 7.40 Minuten, von Markus Wolf. Sehr schön gemacht und überblendet.
Super 8-Fassung namens „Das Todespendel – die Burg des Grauens“, 16 Minuten.
Super 8-Fassung 2: „Die Schlangengrube des Dr. Dracula“, 15.22 Minuten, fast quadratisches Bild. Ganz anders geschnitten als die andere Fassung. Ohne den Prolog, und nach drei Minuten ist man schon im Gruselschloss.
Audio Interview mit Karin Dor (39.55 Minuten), vom ersten Berufswunsch (Innenarchitektin), über die Dreharbeiten zu „Man lebt nur zweimal“ zur „Schlangengrube“ (sie fand Christopher Lee, oft als arrogant verschrieb, sehr nett). Man erfährt auch, dass Fred Astaire „ein Schatz“ war und dass sie ihren Film „Haie an Bord“ ziemlich schlimm fand. Die Audio-Qualität ist bescheiden, man muss schon sehr genau hinhören.
Internationale Artwork-Galerie (4.42 Minuten), 48 Motive.
Bilder von den Dreharbeiten, (3.24 Minuten), 35 Motive fast alle in Schwarzweiß.

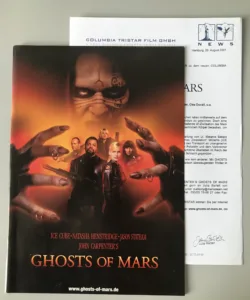





















Neueste Kommentare