
Amber Midthunder als Naru and Dane DiLiegro als Predator. Foto: David Bukach / 2022 20th Century Studios
Irgendwann konnte einem dieses Monster aus dem All schon leidtun: 1987 schlich es im Film „Predator“ erstmals durch den Dschungel, jagte dort aus Spaß an der Safari-Freude Menschen, legte sich dabei aber mit dem Falschen an: Arnold Schwarzenegger, in der Blüte seiner Jahre, auf der Höhe seiner Muskelpotenz und seiner glasklaren Logik – anlässlich von ein paar Tropfen neongrünen Außerirdischen-Bluts schloss er messerscharf: „Wenn es blutet, können wir es auch töten.“ Damit war das Ende des außerirdischen Jägers besiegelt. „Predator“ war damals ein mittlerer Kino-Hit, heute gilt der schnörkellose Film als Actionklassiker, dem neben Comics und Videospielen auch einige Arnold-freie Fortsetzungen folgten. Die hießen mal „Predator 2“, „Predators“ oder „The Predator“, zwischendurch trieben Verzweiflung und Ideenarmut das Studio Fox dazu, die Kreatur mit einem Monster-Kollegen gemeinsam ins Kino zu bringen – jenem Alien aus „Alien“. Nach dem schwachen Wiederbelebungsversuch „The Predator“ von 2018 war die Monsterreihe so tot wie die vielen Opfer des außerirdischen Jägers.
Kinostart wäre verdient gewesen
Durch diese Leichenhalle der überflüssigen Filme weht nun ein vergleichsweise frischer Wind, mit der bislang gelungensten Fortsetzung beziehungsweise Vorgeschichte: „Prey“ heißt sie, distanziert sich durch das Weglassen des Wortes „Predator“ schon von seinen Vorgängern und bietet einen cleveren Kniff. Er spielt nicht in der Gegenwart, sondern in Nordamerika vor 300 Jahren, das der Film in prächtigen Naturaufnahmen zeigt, denen man eine große Leinwand gewünscht hätte – warum der Film nicht ins Kino gebracht wurde, sondern direkt ins Streamingprogramm gepackt wurde, wissen die Götter oder die Entscheider bei Disney, denen die Reihe mittlerweile gehört.

Amber Midthunder als Naru auf der Jagd. Foto: David Bukach / 2022 20th Century Studios
Im Film, inszeniert von Dan Trachtenberg („10 Cloverfield Lane“), hat die junge Comanchin Naru (Amber Midthunder) zwei Gegner: später den Außerirdischen, der in der Prärie Mensch und Tier jagt, von Anfang an aber das Patriarchat. Naru will auch jagen wie ihr Bruder und die anderen Comanchen, doch die Männer trauen ihr das nicht zu und sehen sie bei der Jagd lieber als Sanitäterin, da sie sich so gut mit Heilkräutern auskennt. „Warum willst Du jagen?“, fragt die Mutter. Die Tochter antwortet schmollmundig: „Weil alle denken, dass ich das nicht kann.“ Nun muss man „Prey“ nicht gleich als filmische Speerspitze des Feminismus bejubeln, denn komplexer als in diesem Dialog wird es nicht, aber diese Grundkonstellation ist reizvoll.
Der Horror und seine Trickkünstler: Die Doku „The Frankenstein Complex“
Dass in den Wäldern ein unbekanntes Wesen umgeht, das die Nahrungskette aufwärts würdige Gegner zum Kampf sucht – nach Schlange und Wolf einen nicht völlig überzeugend computergetricksten Bären – ahnt Naru. Aber niemand will ihr glauben. Als man das endlich tut, wird es blutig – und filmisch spannend. Was „Prey“ mit dem ersten „Predator“ verbindet, ist die willkommene Einfachheit des Plots, ausgedacht von Drehbuchautor Patrick Aison. Im Film von 1987 trat eine Bande von US-Söldnern gegen den Jäger an, der ihr die Macho-Attitüde, die markigen Sprüche und das Vertrauen in ihre Hightech-Waffen schnell austrieb. Das war schnörkelloses Actionkino und gleichzeitig eine hintersinnige Parodie desselben, als den Über-Machos (außer Arnold) langsam der Angstschweiß den Männerbauch hinunterlief. Zurück blieben im Finale nur Schwarzenegger, reduziert auf Speer und Lendenschurz, contra Monster. So simpel wie effektiv. So ähnlich ist es, man ahnt es, auch bei „Prey“, wobei Naru mehr Grips als weiland Arnold einsetzen muss.

Amber Midthunder als Naru. Foto: 2022 20th Century Studios
Das Finale ist schon fast Routine, der Höhepunkt liegt eher in der Mitte des Films: Denn da treten ganz andere Jäger auf – französische Trapper, die keinerlei Interesse an den Ureinwohnern ihrer neuen Heimat haben und Naru in einen Käfig sperren. Tags darauf, als ihnen klar ist, was da jagend durch die Natur schleicht, binden sie sie an einen Baum, in der Hoffnung, so die Kreatur anzulocken. Diese Sequenz auf einem nebelverhangenen Hügel, auf dem die Trapper gegen den Jäger aus dem All gnadenlos scheitern, der allerlei Waffen mit sich führt und sich unsichtbar machen kann, gehört zu den besten und spannendsten der gesamten Reihe. Und man gönnt den Trappern ihren Untergang, da man weiß, wie sie mit den Ureinwohnern umgehen. Das ist ein schöner Kniff des Films: Zwar deutet der Abspann mit einer Animation von fiktiven indigenen Zeichnungen an, dass längst weitere Außerirdische unterwegs in die Prärie sind – aber wenn Naru am Ende ihrem Stamm sagt, dass man hier nicht mehr sicher sei, kann sie ebenso die Gefahr durch die Neu-Amerikaner meinen, die die Indigenen verdrängen wollen. Wenn man solche Feinde hat, ist ein Außerirdischer nicht das größte Problem.
„Prey“ ist bei Disney+ zu sehen, wie auch die anderen „Predator“-Filme – und jetzt auch auf Bluray und UHD zu haben, bei Disney/Leonine.

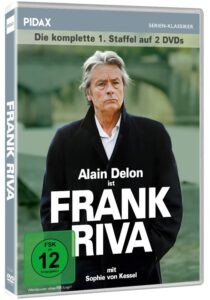


















Neueste Kommentare