
Die Bühne ist seine Heimat, mag sie noch so klein sein oder noch so verräuchert: Voodoo Jürgens als Musiker „Rickerl“ in einer Szene des Films, der an vielen atmosphärischen Wiener Schauplätzen entstanden ist. Foto: Alessio M. Schroder / Giganten Film /Pandora Film
Der Film „Rickerl“ hat die 45. Ausgabe des Filmfestivals Max Ophüls Preis eröffnet. Er erzählt vom Wiener Musiker Erich „Rickerl“ Bohacek und dessen Versuch, von seiner Kunst zu leben. Aber ihm bleiben vor allem das Tingeln durch Wiener Kneipen oder Auftritte bei Begräbnissen. Die Hauptrolle spielt der Wiener Liedermacher Voodoo Jürgens. Regisseur und Autor des Films ist Adrian Goiginger, dessen erster Spielfilm „Die beste aller Welten bei der Berlinale lief.
Glückwunsch zum Film und zum Platz als Eröffnungsfilm in Saarbrücken – wie kam es dazu?
GOIGINGER Wir sind einfach eingeladen worden – da „Rickerl“ mein vierter Spielfilm und Ophüls ein Nachwuchsfestival ist, hätte ich auch nicht mehr in den Wettbewerb gepasst. Wir freuen uns sehr – und es hilft uns auch bei unserem deutschen Kinostart am 1. Februar.
Waren Sie vorher schon mal beim Ophüls-Festival?
GOIGINGER Nein, aber wir wären gerne mal hier gewesen – 2016 hatten wir „Die beste aller Welten“ für den Wettbewerb eingereicht, wurden aber nicht genommen. Dann hatte der Film seine Premiere bei der Berlinale 2017. Das war auch nicht schlecht.

Der Regisseur und Autor Adrian Goiginger (32). Sein nächstes Kinoprojekt nach „Rickerl“ ist „Vier minus drei“ nach dem Buch von Barbara Pachl-Eberhart. Foto: Giganten Film
Am Anfang von „Rickerl“ ist ganz kurz Regisseur Arman T. Riahi als Friedhofsgärtner zu sehen. Er und sein Bruder Arash, auch Regisseur und Produzent, sind mit ihren Filmen regelmäßig beim Ophüls-Festival dabei. Wie kam es zu dem Gastauftritt?
GOIGINGER Ich hatte in seinem Film „Fuchs im Bau“, der ja auch bei Ophüls lief, eine kleine Rolle gespielt, da hatte er mich ins kalte Wasser geschmissen – und das habe ich jetzt mit ihm gemacht. Wir sind Freunde und haben wir uns den Gag erlaubt, uns gegenseitig zu besetzen. Es sind nur winzige Rollen, denn Schauspieler sind wir beide nicht.
Wie bekannt ist Ihr „Rickerl“-Hauptdarsteller Voodoo Jürgens, bürgerlich David Öllerer, in Österreich? Es liegt sicher an mir, aber ich hatte zuvor von ihm noch nie gehört.
GOIGINGER In Österreich ist er sehr bekannt, dort kennt fast jeder seinen Namen, in Wien jeder – da sind seine Konzerte immer ausverkauft. In Deutschland kennt man ihn eher in den großen Städten, er hat da ein junges urbanes Publikum.
War er der Anstoß zum Film? Oder hatten Sie erst die Idee zu „Rickerl“ und mussten dann den richtigen Darsteller suchen?
GOIGINGER Ohne Voodoo würde es den Film gar nicht geben. Erst durch seine Musik bin ich auf die Idee des Films gekommen, der eben nur mit ihm in der Hauptrolle und mit seiner Musik funktioniert. Ich habe ihn dann ganz offiziell über das Management kontaktiert, zu einem Casting eingeladen. Insgesamt hat es vier, fünf Jahre gedauert vom ersten Treffen bis zum fertigen „Rickerl“ – was für einen Film ziemlich normal ist.
Musiker Stefan Mathieu: „Ein Werk darf auch verschwinden“
Wie haben Sie das Drehbuch geschrieben?
GOIGINGER Wir haben uns immer wieder getroffen, er hat mir Geschichten erzählt, ich habe ihn ausgefragt über seine Texte, wir haben über Figuren gesprochen, darüber, welche Songs unbedingt in den Film müssen – und das Ganze habe ich dann als Drehbuchautor zusammengefasst.
Voodoo ist nun kein Schauspieler – hatten Sie Angst, dass das nicht funktioniert?
GOIGINGER Am Anfang schon, deshalb haben wir einen Probedreh gemacht und an einem Tag einen Kurzfilm gedreht. Dann haben wir fünf, sechs Wochen geprobt. Da war mir klar, dass er das Ganze sehr ernst nimmt und dass er grundsätzlich Talent hat – technische Dinge kann man ja lernen.
Aber er spielt nicht sich selbst?
GOIGINGER Nein, er hat das selbst am besten gesagt – er hat die Kunstfigur Voodoo Jürgens geschaffen und jetzt die Kunstfigur Rickerl, der er seine Songs leiht. Es gibt zwar Parallelen zwischen Rickerl und Voodoo – er war selbst auch oft beim „Service für Arbeitssuchende“, hat bei einem Friedhof gearbeitet – aber der Film ist keine Biografie. Biopic ist nicht mein Genre. Uns ging es um das Lebensgefühl der Texte und das in Wien.
Der Film hat in der deutschen Kinoversion deutsche Untertitel – auch in Österreich?
GOIGINGER Nein, der Dialekt ist in Österreich leicht verständlich. Da gibt es schwerer verständliche – im Vorarlberg oder in Tirol etwa. In Deutschland hat der Film je nach Region Untertitel oder nicht. In Bayern sollte es ohne Untertitel gehen, aber nördlich von der Isar kann es dann schon eng werden. Ich bin selbst ja kein Wiener, sondern Salzburger – deshalb musste mein Drehbuch erstmal ins Wienerische übersetzt werden, das ich nicht beherrsche. Als Nicht-Wiener Österreicher hat man generell eine gewisse Hassliebe in Richtung Wien. Man mag die Wiener nicht so, weil sie so „großkopfert“ wirken und ein bisschen auf die Bundesländer herabschauen. Zugleich bewundert man sie auch, weil sie so einen Schmäh haben, so einen Wortwitz. Den Humor würde ich mit dem jüdischen Humor vergleichen, ein bisschen makaber, dabei elegant.
Wie haben Sie als Nicht-Wiener die Wiener Drehorte gefunden und ausgesucht?
GOIGINGER Mir wären nur die üblichen touristischen Drehorte eingefallen. Aber Voodoo kennt sich aus, hatte seine Ideen, und im Team waren vor allem Wienerinnen und Wiener, das hat geholfen.
Es gab keine Studiosets oder Ähnliches?
GOIGINGER Nein, wir waren an Originalschauplätzen, haben mit möglichst kleinem Team gearbeitet und in den Kneipen auch ein paar Stammgäste als Schauspieler engagiert – mit einer kleinen Rolle und ein paar Sätzen. Das schafft eine schöne Authentizität.
Der Film ist digital gedreht, was ja oft eine sehr glatte Anmutung hat. „Rickerl“ sieht aber schön körnig aus, manchmal fast wie altes 16-Millimeter-Material.
GOIGINGER Kameramann Paul Sprinz hat alles versucht, um einen möglichst analogen Look zu schaffen. Wir konnten nicht mit analogen Filmkameras drehen, das kostet mehr, auch die Beleuchtung ist aufwändiger, das hätte uns im Ablauf gestört. Auch inhaltlich wollten wir einen nostalgischen Retro-Charme schaffen. Rickerl hat kein Smartphone, und man darf noch überall rauchen.
Es wird auffällig viel geraucht in Ihrem Film.
GOIGINGER In Österreich gibt es ja im Gegensatz zu Deutschland ein komplettes Rauchverbot. Das hat ganz viele Wiener hart getroffen, denn in den vielen Caféhäusern gehört das Rauchen zum Teil der Kultur. Da dachten wir, wir drehen eine Komödie, die etwas überhöht und überspitzt ist – und da darf man überall noch rauchen, im Kino, in der Straßenbahn und so weiter.
Wie dreht man denn Rauch-Szenen in den Kneipen, wenn es Rauchverbot gibt?
GOIGINGER Für Filmdrehs gibt es natürlich Ausnahmen. Man darf ja auch privat keine Autos in die Luft jagen.
Ihr Film ist sehr bittersüß, bringt Witz und Melancholie zusammen. Haben Sie da ein Vorbild?
GOIGINGER Ja, Charlie Chaplin. Bei seinem Film „The Kid“ gibt es anfangs einen Text, dass man als Publikum bei dem Film lachen kann – und vielleicht auch eine Träne vergießen. Bei Filmen wird ja manchmal vergessen, dass es das gleichzeitig gibt. Nur Komödie oder nur trauriger Film – das mag ich nicht. Beides im Film zu haben, war eigentlich nicht so schwierig, weil wir durch den Wortwitz schon einigen Humor haben, und die Vater-Sohn-Beziehung ist sehr anrührend.
Im Film schaut sich Rickerl Szenen aus den 60er-Jahre-Filmen „Heißes Pflaster Köln“ und Die liebestollen Dirndl von Tirol“ an – beides von der berühmt-berüchtigten Produktionsfirma Lisa Film, die uns unter anderem „Ein Schloss am Wörthersee“ und die „Supernasen“-Filme mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger kredenzt haben. Wie kamen Sie auf die Filme?
GOIGINGER „Heißes Pflaster Köln“, einer der Lieblingsfilme von Voodoo, wollte ich unbedingt im Film haben. Der spielt in Köln im Unterweltmilieu, das plötzlich von Gangstern aus Wien aufgemischt wird, was sehr witzig ist. Und „Liebestolle Dirndl“ läuft ja in einem Sex-Shop, in dem der Rickerl arbeitet. Da schaut sich sein Sohn die ersten Minuten von diesem Fummel- und Schmuddelfilm an. Und so war es auch bei mir: Meine Mutter hat in einem Sex-Shop gearbeitet, und ich habe als Kind von solchen Filmen die ersten fünf oder zehn Minuten sehen dürfen – in denen eben noch nichts geschehen ist.
Ihr Film läuft jetzt bei einem Festival, das sich dem Nachwuchs widmet – was würden Sie diesem Nachwuchs raten?
GOIGINGER Ich bin früh mit Filmen gescheitert, die ich nach irgendwelchen Bedürfnissen ausgerichtet habe. Da dachte ich mir: Dann kann ich das auch mit Filmen tun, an denen mein Herz hängt. Und ab da lief es besser. Man sollte nicht spekulieren, was vielleicht gut ankommen kann. Man ist immer am besten, wenn man 100 Prozent an das glaubt, was macht. Ich weiß, dass das kitschig klingt – aber es stimmt eben.
Der Film läuft noch einmal am Freitag, 26.1., um 19.30 Uhr im Cinestar. Bundesstart am 1. Februar über Pandora Film.
Karten, Programm, Termine:
www.ffmop.de















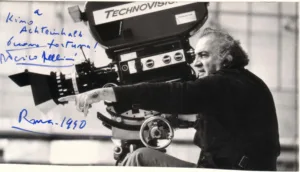











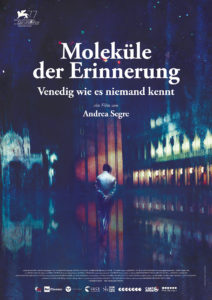
Neueste Kommentare