
Flix, fotografiert von Katharina Pfuhl.
Eine ungewöhnliche Idee war das – und der Beginn einer großen Karriere. In Saarbrücken vor 20 Jahren reicht der Student Felix Görmann seine Diplomarbeit bei der Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBK) ein: „Held“. Ein Comicband, halb autobiografisch, halb fiktiv. Ein Comic ist damals als Abschlussarbeit an der HBK unerhört, das Diplom bekommt Görmann aber doch. Mittlerweile (und schon lange) ist der Zeichner und Texter, Jahrgang 1976, bundesweit bekannt als Flix. Er zeichnet für den „Spiegel“, die „Zeit“ und die „FAZ“, hat sich 2010 dem „Faust“ gewidmet, 2016 dem „Münchhausen“, zusammen mit dem saarländischen Kollegen Bernd Kissel. Zum 20. Geburtstag ist nun „Held“ als Gesamtausgabe erschienen – mit den Fortsetzungen „Sag was“ (2004) und Mädchen“ (2006). Wir haben mit Flix gesprochen.
„Held“ erscheint zum 20. Geburtstag als große Jubiläumsausgabe. Wie kommt‘s?
FLIX Weil „Held“ für mich ein persönlicher Meilenstein ist, auf mehreren Ebenen. Zum einen war es meine Diplomarbeit an der HBK in Saarbrücken, zum anderen ist es eine Art Autobiografie – zumindest eine halbe, weil die zweite Hälfte ja erfunden ist.
Damals waren Sie Mitte 20 – wie kamen Sie auf die Idee einer Autobiografie, die Ihr Leben weiterdenkt, bis hin zum Tod im gesetzten Alter?
FLIX Damals habe ich viele Biografien über Künstlerinnen und Künstler gelesen. Ich hatte dabei immer das Gefühl, dass an deren Lebensende alles einen Sinn ergibt. Dass sich alle Teile zusammenfügen, so wie etwa bei Johnny Cash, der nach Jahren der Krise am Ende noch ein paar tolle Alben aufnahm. Da habe ich mir sehr gewünscht, dass so etwas mal in einem Buch über mich drin stehen würde. Denn damals hat mich die Frage umgetrieben, wie das weitergehen soll mit mir. Ist es überhaupt realistisch, Comiczeichner sein zu wollen? Davon leben zu wollen? Deswegen habe ich mir das Buch selber geschrieben, mit einem relativen Happy End. Das sich jetzt 20 Jahre später anzuschauen und sich zu fragen, was davon stimmt und was nicht, wo ich vielleicht hellsichtiger war als gedacht hat, ist schon interessant für mich.

Wo waren Sie denn hellsichtig?
FLIX Ich habe zum Beispiel ein wenig vorhergesehen, dass in der Zukunft ein Kühlschrank selbstständig übers Internet Milch nachbestellt, wenn sie knapp wird. Wahr wurde auch, und das ist für mich wichtiger als der Kühlschrank, dass ich als Comiczeichner durchs Leben gehe. Auch wurde mir klar, dass man sich als Person sozusagen noch einmal überarbeiten kann: Wenn mich jemand warnte – „pass auf, wenn Du so weitermachst, geht es Dir wie in ‚Held‘“ – , dann habe ich das sehr ernst genommen. In „Held“ habe ich auch geschrieben, dass ich mal einen Comicstrip in der FAZ haben würde – den ich jetzt tatsächlich habe. Das ist schon irre.
Comic-Klassiker „Mac Coy“
Also eine Art selbst erfüllende Prophezeiung?
FLIX Daran glaube ich nicht – aber daran, dass es etwas bringt, Dinge, Ideen, Wünsche zu formulieren. Doch letztendlich ist vieles schlicht Glück. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die sehr talentiert sind, tolle Sachen machen – und unter dem Radar laufen. Und manche werden abgefeiert, und ich frage mich da schon, warum und wieso.
Sie haben in Saarbrücken studiert. Wie haben Sie die Stadt damals empfunden, als gebürtiger Münsteraner?
FLIX Großgeworden bin ich ja in Darmstadt, das ähnlich ist wie Saarbrücken – eine Stadt voller Kriegsschäden, die man relativ pragmatisch wieder aufgebaut hat. Ich fand Saarbrücken damals super, gerade weil die Stadt nicht so groß ist. Berlin oder Hamburg hätten mich erstmal überfordert, ich hätte da zu wenig studiert. Saarbrücken bot die große Chance, sich ganz auf die Arbeit zu konzentrieren – die Stadt würde ich jederzeit empfehlen. Für einige Jahre diesen Kosmos Kunsthochschule zu haben, diesen wunderbar geschützten Raum, in dem man experimentieren kann, ohne sich sofort vergleichen zu müssen, ist toll. Raus in die Welt kann man später immer noch.

Eine Seite aus „Held“. Foto: Flix/Carlsen
Wie war es damals, einen Comic als Diplomarbeit einzureichen?
FLIX Schwierig war das. Ich hatte schon im Grundstudium versucht, Comics zu machen – da bin bei den Professorinnen und Professoren aber weitgehend gescheitert. Das ist kein persönlicher Vorwurf – zu dieser Zeit war das noch kein geschätztes Medium, selbst nicht in dieser progressiven, aufgeschlossenen Umgebung. Ich bin froh, dass ich mich darüber hinweggesetzt habe und mit ein wenig Trickserei ein Comic als Diplomarbeit eingereicht habe. Später hat die HBK dann sogar den Studiengang „Graphic Novel“ eingerichtet. Wenn man etwas macht, ist es, wie wenn man Steine in einen See wirft – da gibt es Wellen, und die kommen am anderen Ufer an. Das ist eigentlich das Schönste an dieser Diplomarbeit. Sie hat Raum geschaffen. Es gibt ja einige Aktive in Saarbrücken, zum Beispiel Elizabeth Pich und Jonathan Kunz mit ihrem erfolgreichen Comic „War and Peas“. Jonathan hatte mich auch mal, als die HBK ihn noch als Lehrbeauftragten beschäftigt hat, zu einem seiner Hochschul-Comicsymposien eingeladen. Ich nehme an, heute wäre in Saarbrücken ein Comicdiplom eher möglich als früher.
Comicband „Turing“
Sie teilen sich ein Atelier mit dem Kollegen Marvin Clifford, mit dem Sie auch immer wieder mal arbeiten. Wie teilen sie sich ein – gehen Sie zu klassischen Bürostunden ins Atelier?
FLIX Nein, ich habe zwei Töchter, und der Alltag der Kinder, wann sie weg und wann sie wieder da sind, gibt den Rhythmus vor. Deshalb muss ich immer dann loslegen, wenn ich gerade die Gelegenheit dazu habe.

Eine Seite aus „Held“. Foto: Flix/Carlsen
Wenn Sie „Held“ jetzt, 20 Jahre später, nochmal texten und zeichnen würden – würden Sie anders arbeiten?
FLIX Natürlich – es wäre ja eine Schande, wenn ich nichts dazugelernt hätte. Diese schöne naive Energie, die man als junger Mensch hat, die habe ich heute natürlich nicht mehr. Insgesamt würde ich „Held“ heute wohl komplizierter machen – aber vielleicht nicht besser.
„Held“ erzählt auch vom eigenen Tod – sehen Sie dieses Thema jetzt, 20 Jahre später, anders als damals?
FLIX Ja, schon. Ich bin zwar noch nicht in die erste Reihe gerückt, aber von der dritten in die zweite, von der Enkelgeneration zur Elterngeneration. Da steht einem das Thema näher. Robert Gernhardt hat wunderbare Gedichte über den Tod geschrieben – als er noch jung war. Später, als er todkrank war, hat er das nicht mehr getan. Auch Reinhard Mey und Udo Jürgens haben große Songs über das Sterben geschrieben – als junge Leute, im Alter nicht mehr. Da ist die Scheu wohl größer. So gesehen ist es gut, dass ich das mit dem Tod schon mal erledigt habe.
Wie hat sich in den 20 Jahren seit „Held“ die Comic-Szene verändert und entwickelt?
FLIX Damals gab es noch viel mehr Vorurteile über Comics: dass sie vor allem für Menschen da sind, die nicht vernünftig lesen können oder wollen, für etwas simplere Gemüter oder für Kinder, die ja ohnehin gerne unterschätzt werden. Lange wurde nicht begriffen, dass Comic kein Genre ist, sondern ein Medium – wie Film, der ja alles sein kann, von „Paw Patrol“ bis „Oppenheimer“. Man kann auch im Medium Comic alle Themen verhandeln.
Es gab vor Jahren einen etwas angestrengt wirkenden Versuch, den Begriff „Graphic Novel“ zu etablieren, damit man nicht mehr „Comic“ sagen muss und so möglicherweise die üblichen Vorurteile vermeidet. Hat sich das ausgezahlt?
FLIX Natürlich ist „Graphic Novel“ ein Label, ein Aktivistenbegriff. Dass der Begriff keine Dauerlösung ist, war damals allen klar. Aber es war der Versuch, den Radius zu erweitern – und das hat funktioniert, er hat Türen geöffnet. Wenn man sich heute das Sortiment in einer breiter aufgestellten Buchhandlung anschaut, dann sieht man im Comicregal einen Riesenunterschied zum Angebot vor 20 Jahren: mehr Themen, mehr Herkunftsländer, viel mehr Nischen.
Kitschtorte „Flash Gordon“
Sie verweisen auf Frank Millers düstere „Batman“-Neuerfindung „Batman: The Dark Knight Returns“ von 1986 als großen Einfluss – darauf kommt man beim Blick auf Ihre Arbeiten nicht unbedingt.
FLIX Bei Miller war es so, dass ich durch ihn grundlegend begriffen habe, dass man die Dinge nicht als gegeben hinnehmen muss. Millers „Batman“ war ein großer Umbruch – vom klassischen Heldentum zu eine großen Ernsthaftigkeit, zum Depressiven, zur Wut. Das war für mich vollkommen neu. Mir wurde klar, dass man große Gefühle in Comics packen kann, dass man sich einen eigenen Weg suchen kann, dass man das auch allein hinkriegen kann – Miller ist ja so eine Art Ein-Mann-Armee. Er vermittelte mir vor allem dieses punkige „Das kann ich auch.“
Miller war aber nicht Ihre erste Comic-Lektüre, oder?
FLIX Nein, als Kind habe ich viel franko-belgische Comics gelesen, auch weil die leicht zu haben waren – etwa in der Stadtbibliothek in Darmstadt: „Asterix“, „Lucky Luke“, „Clever und Smart“, „Fix und Foxi“, „Zack“, auch Kram wie die „Die Sturmtruppen“. Erst mit 16 hat sich da eine andere Welt aufgetan. Vor der Bushaltestelle an meiner Schule machte ein Laden auf, halb Kinderbuchhandlung, halb Comic-Shop. Ich habe mich dort mit einem Azubi angefreundet, der mich mit allen US-Sachen versorgt hat – eben auch mit Frank Miller.
„War and Peas“ stellen aus
Wenn Sie auf Ihre ersten 20 Jahre als Comic-Künstler zurückblicken – welche Werke sind Ihnen die wichtigsten?
FLIX Klar, „Held“ war das erste große Ding und gab mir das Gefühl, dass das mit dem Berufswunsch tatsächlich gelingen kann. Meine „Faust“-Adaption von 2009, damals für die FAZ, ist auch wichtig. Ein Dauerbrenner, der an Schulen gelesen, an Unis besprochen wird. „Faust“ und die Deutschen – das funktioniert. Das nächste wirklich Große war dann „Spirou in Berlin“.

Die Fortführung von „Spirou“. Foto: Flix/Carlsen
Da wurden Sie 2018 als erster deutscher Zeichner und Texter gefragt, ob sie einen Band für den frankobelgischen Klassiker „Spirou und Fantasio“ gestalten wollen. Das hätte schief gehen können.
FLIX Natürlich, die belgischen Rechteinhaber hätten den Band bei Nichtgefallen auch geflissentlich in der Versenkung verschwinden lassen können. Aber er läuft europaweit, bis heute, was man vorher nicht wissen konnte. Der deutsche Botschafter in Brüssel nutzt das Buch ständig als Gastgeschenk, es ist eine schöne Vermittlung: ein deutsches Thema mit einer belgischen Ikone. Was mich besonders freut – gerade habe ich eine Einladung vom belgischen König bekommen, Kulturbotschafter zwischen den Ländern zu sein. Das ist schon cool.
Es ist also gut gegangen bei Ihnen?
FLIX Ja, ich sehr dankbar für diese Naivität vor 20 Jahren, zu glauben, dass es irgendwie schon klappen wird. Hätte ich mir die Chancen realistisch ausgerechnet, hätte ich es nicht gemacht. Es hat mir sehr geholfen, nicht weiter darüber nachzudenken.
Flix: Held. Gesamtausgabe. Carlsen Comics, 368 Seiten, 35 Euro. www.carlsen.de
Kontakt: www.der-flix.de
























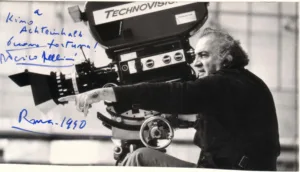

Neueste Kommentare