
Nils Daniel Peiler an seinem neuen Arbeitsplatz, dem Saarbrücker Filmhaus. 1988 in Saarbrücken geboren, hat Peiler Germanistik und Bildwissenschaften der Künste in Saarbrücken sowie Film- und Medienwissenschaften in Frankfurt, Paris und Amsterdam studiert. Promoviert hat er über die Rezeptionsgeschichte von Stanley Kubricks „2001: Odyssee im Weltraum“. Foto: Oliver Dietze
Nils Daniel Peiler ist neuer Leiter des Saarbrücker Filmhauses. Der Filmwissenschaftler aus Saarbrücken, der zuletzt einige Jahre Kurator für die Kinemathek Hamburg und deren Metropolis Kino war, ist in der hiesigen Szene gut bekannt – im Kino Achteinhalb war er für einige denkwürdige Reihen und Veranstaltungen verantwortlich. Was hat er im Filmhaus vor?
Im Filmhaus haben Sie sich als Kind und Jugendlicher viele Filme angeschaut, jetzt sind Sie der Leiter des Kinos – ein merkwürdiges Gefühl?
PEILER Ein sehr schönes. Wenn ich durch die Räume gehe oder in den Kinosaal, fallen mir die vielen Filme ein, die ich hier gesehen habe.
Was war der erste im Filmhaus?
PEILER Disneys „Alice im Wunderland“, da war ich sechs oder sieben Jahre alt. Meine Mutter nahm mich mit ins Kino, wofür ich ihr auf ewig dankbar bin. Eigentlich sollte „Bambi“ laufen, dann wurde das Programm geändert, „Alice im Wunderland“ lief – und bescherte mir nachhaltige Albträume. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, weiter ins Kino zu gehen. Als Jugendlicher und junger Erwachsener bin ich weiter viel ins Filmhaus, habe jede Menge gesehen. Unvergessen ist zum Beispiel „Wie im Himmel“, der größte Erfolg im Filmhaus, der hier über zwei Jahre lang ununterbrochen lief. Das ist auch der Film, über den ich meinen ersten Kinotext geschrieben habe. „Wie im Himmel“ wird hier bald nochmal laufen, viele Kinogängerinnen und Kinogänger haben den Titel in das Filmwunschbuch geschrieben, das jetzt an der Kasse ausliegt.
Wie es dem Kino Achteinhalb geht
Wie kamen Sie auf die Idee des Wunschbuchs?
PEILER Die habe ich mir vom „Prince Charles Cinema“ in London abgeschaut. Dort gibt es im Kinofoyer eine große Tafel, auf die das Publikum mit Kreide seine Wünsche schreibt. Jetzt haben wir im Filmhaus auch eine Tafel und ein Buch im Foyer, die bieten eine schöne Interaktion mit dem Publikum – es wird eine neue Sektion mit Publikumswünschen geben.
Zuletzt waren Sie Kurator bei der Kinemathek Hamburg – haben Sie lange überlegt, sich auf die Stelle in Saarbrücken zu bewerben?
PEILER Überhaupt nicht. Und nach dem Vorstellungsgespräch ging alles sehr schnell. Meine Vorgängerin Christel Drawer hat mich eingearbeitet und noch einige Renovierungsarbeiten angestoßen, unter anderem die der Schaukästen, da bin ich ihr sehr dankbar. Im Vorstellungsgespräch war schnell klargeworden, dass es eine große Schnittmenge gibt zwischen dem, was die Stadt sich vorstellt, wie das Haus noch mal neu aufgestellt werden kann, und dem, was ich an Ideen mitbringe.
Welche sind das – was wird sich ändern im Filmhaus?
PEILER Es wird mehr Veranstaltungen mit Gästen geben, mehr Diskussionen, Einführungen, Podiumsgespräche. Wenn eine Regisseurin, ein Regisseur kommt, gibt es immer viel Zuspruch. Ich wünsche mir eine filmische Vielfalt für ein breites Publikum, das sich im Filmhaus einbringen soll. Ich begrüße das Publikum ja gerne persönlich, um den Leuten zu sagen, dass ich mich freue, dass sie da sind – das ist aufrichtig gemeint und keine hohle Phrase. Ich bin froh, wenn ich angesprochen werde, wenn Anrufe oder Mails kommen mit Wünschen und mit Rückmeldungen. Externe Ideen sind wichtig, nur dann kann das Programm bunt und vielfältig werden. Ich will es ja nicht alleine bestimmen.
Das Saarbrücker Kinomagazin „35 Millimeter“
Aber Etabliertes wird bleiben?
PEILER Natürlich, unsere Reihe „Filmreif“ zum Beispiel: Alle zwei Wochen gibt es am Montagnachmittag ab 15 Uhr einen Film, dazu Kaffee und Kuchen, für insgesamt fünf Euro. Zwischen 80 und 120 Personen kommen da regelmäßig zu uns, sie verabreden sich Wochen vorher, sitzen zusammen, reden und reservieren schon mal fürs nächste Mal. Das wird auf jeden Fall weitergehen.
Wird es thematische Reihen geben, auch Retrospektiven?
PEILER Ja – Stanley Kubricks Tod jährt sich 2024 zum 25. Mal, an seinem Geburtstag am 26. Juli beginnen wir eine vollständige Retrospektive mit allen Kubrick-Filmen. Wir starten mit seinem letzten Film „Eyes Wide Shut“ von 1999, dann geht es Woche für Woche mit 13 Produktionen zurück bis hin zu seinen frühen Kurzfilmen. Wir werden die Werke sowohl im Original, mit und ohne Untertitel, als auch synchronisiert zeigen. Und zur Eröffnung beehrt uns Tochter Katharina Kubrick aus London persönlich.

Über die Schulter schauen ihm die in Saarbrücken geborenen Regisseure Max Ophüls (1902-1957, links) und Wolfgang Staudte (1906-1984). Foto: Oliver Dietze
Sie haben über Kubricks „2001“ promoviert und im Kino Achteinhalb mal eine Vorführung mit durchgehendem Live-Kommentar gemacht. Wird es im Filmhaus Ähnliches geben?
PEILER Ich gebe zu jedem Film der Kubrick-Retro eine kurze Einführung. So eine ausladende Retrospektive im Filmhaus ist für uns natürlich ein Experiment, von dem ich hoffe, dass das Publikum es annimmt. Vielleicht interessieren sich auch Menschen in der Großregion dafür und kommen mal nach Saarbrücken. Abgesehen von Kubrick wird es eine Reihe zum 40. Todestag des in Saarbrücken geborenen Regisseurs Wolfgang Staudte geben, in Zusammenarbeit mit der Saarbrücker Staudte-Gesellschaft. Auch mit dem Filmfestival Max Ophüls Preis wird es mehr Zusammenarbeit geben.
Hoffen Sie auch auf mehr junges Publikum?
PEILER Ja, da gibt es noch Luft nach oben. Ich würde das Filmhaus gerne öffnen für alternative Formate, etwa für mehr Kurz- oder Hochschul-Abschlussfilme. Vor drei Wochen habe ich ganz zufällig den Filmemacher Axel Ranisch vor dem Filmhaus getroffen, der gerade Gastdozent ist an der Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBK). Im Sommer, wenn er das nächste Mal wieder mit seiner Filmklasse hier in Saarbrücken beschäftigt ist, machen wir zusammen eine Werkschau und zeigen in seiner Anwesenheit seinen persönlichen Lieblingsfilm. Wir wollen auch verschiedene Gewerke und Berufswege filmisch vorstellen – Regie, Schnitt, Produktion und so weiter. Generell versuche ich, ein neues Publikum zu gewinnen – aber auch Menschen zurück zu gewinnen, die möglicherweise lange nicht mehr im Kino waren.
Der Plakatflohmarkt am Filmhaus
Vielleicht auch durch Repertoire-Pflege und verdiente Klassiker?
PEILER Die haben im Haus ja eine gute Tradition, auch wenn das in letzter Zeit zurückgegangen ist. Ich werde sie noch mal zurückbringen – darin haben mich auch viele Rückmeldungen im Wunschbuch und auf der Wunschtafel bestärkt. Stummfilme mit Live-Begleitung sind möglich, wir haben ja auch ein Klavier hier.
Wie groß ist das Team des Filmhauses?
PEILER Klein. Wir sind aktuell nur zu dritt, aber sehr engagiert. Die beiden Festangestellten Herr Chelly und Herr Seidel sind seit über 20 Jahren am Haus, haben eine Passion fürs Kino und kennen auch das Saarbrücker Publikum, was für unsere Arbeit sehr wichtig ist.
Wie ist Ihr Verhältnis zu den anderen Kinos in Saarbrücken, vor allem zur Camera Zwo und dem Kino Achteinhalb, mit denen es die meisten filmischen Berührungspunkte geben dürfte – und auch mögliche Überschneidungen?
PEILER Mir ist ganz wichtig: Das Filmhaus soll keine Konkurrenz sein, ich will eine gute Zusammenarbeit, Austausch und Kooperation. Wir haben uns auch schon getroffen und miteinander geredet. Wir haben ein mögliches Publikum, dass wir teilen. Aber jedes Haus besitzt sein eigenes Profil. Das des Filmhauses will ich jetzt aktualisieren. Wir werden zwar Klassiker und Reihen bieten, wollen aber in jedem Fall ein Startkino bleiben, in dem Filme zu ihrem Bundesstart anlaufen. Natürlich gehe ich davon aus, dass die Camera Zwo weiterhin die großen Arthouse-Kinostarts macht. Aber es gibt auch mittlere bis kleinere Verleihe, die mit ihren Filmen bislang gar keinen Start in Saarbrücken bekommen haben. Da sehe ich für uns im Filmhaus einiges Potenzial. Verleiher haben natürlich ein großes Interesse, ihre Titel auch in Saarbrücken zu starten. Mehr Vielfalt also! Wir haben mit 125 Plätzen einen relativ großen Saal – wenn wir auch leider nicht mehr regelmäßig den früheren zweiten Saal bespielen, den „Schauplatz“, wo wir den Film dann weiter zeigen könnten, während im großen Saal ein neuer Film startet.
Was wünscht sich die Stadt von Ihnen kommerziell? Gibt es Vorgaben und Zahlen?
PEILER Ich habe keine konkrete Vorgabe bekommen, was die Auslastung betrifft oder welche Marge ich erwirtschaften soll. Ich bin sehr froh, dass die Stadt mich erstmal ankommen und ausprobieren lässt. Es ist natürlich eine komfortable Situation, dass Saarbrücken sich so ein tolles Haus leistet, ein kommunales Kino in städtischer Trägerschaft. Ich habe in den ersten Wochen hier schon sehr viel Aufbruchsstimmung gespürt – auch hier direkt in der Nachbarschaft in der Mainzer Straße.
Aber auf die Zuschauerzahlen müssen Sie schon schauen, oder?
PEILER Natürlich – ich will ja auch kein Kino in einem fast leeren Saal zeigen. Aber grundsätzlich freue ich mich, dass ich hier eine Grundfinanzierung habe, mit der ich arbeiten kann. Das sind andere Voraussetzungen, als wenn wir ein kommerzieller Spielbetrieb wären. Mein Ansatz als freier Kurator war über die Jahre eine Art Mischkalkulation: Kleinere, vielleicht weniger populäre, aber wichtige Programme sollen von populäreren refinanziert werden.
Nostalgie: Kino-Anzeigen von 1977
Wird sich an den Eintrittspreisen etwas ändern?
PEILER Nein. Die Eintrittspreise sind mit 7,50 Euro, plus Aufschlag bei Überlänge, moderat und werden das auch bleiben. Montags und dienstags kostet es für alle sechs Euro. „Filmreif“ kostet wie gesagt fünf Euro mit Kaffee und Kuchen, durch die Unterstützung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Die niedrigen Preise sind wichtig, denn wir sind ja kein kommerzielles Kino, sondern ein öffentlicher Ort, an dem Menschen zusammenkommen und miteinander in Kontakt kommen sollen. Das ist unsere Aufgabe als städtische Einrichtung. Da müssen wir sozialverträglich und finanziell niederschwellig sein. Wir werden immer auch Veranstaltungen bei freiem Eintritt anbieten, wie Anfang April etwa den Abend mit den Kurzfilmen des in Saarbrücken geborenen und oscarprämierten Animationsfilmers Frédéric Back. In der aktuellen wirtschaftlichen Situation denken viele Menschen schon zwei- oder dreimal darüber nach, ob sie ins Kino gehen. Vielleicht zeigt da auch die Pandemie ihre Wirkung. Früher war der regelmäßige Gang ins Kino eine Selbstverständlichkeit. Das muss wieder gelernt werden – auch das ist Teil unserer Aufgabe.




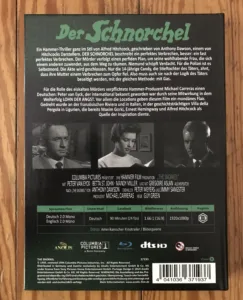















Neueste Kommentare