
Sandra Hüller in einer Szene des Films „Anatomie eines Falls“. Foto: LesFilmsPelleas/LesFilmsDePierre
Sandra Hüller war für einen Oscar und hat – unter anderem – einen César für „Anatomie eines Falls“ gewonnen. Grund genug, ein Interview zu posten, das im Januar 2023 entstand, als Hüller Ehrengast des Filmfestivals Max Ophüls-Preis war.
Schauen Sie sich Filme, in denen Sie mitspielen, später nochmal an?
HÜLLER Manchmal, wenn ein Film im Fernsehen läuft und ich hängenbleibe, schaue ich noch ein bisschen rein – aber gezielt würde ich das nicht tun.
Haben Filmkritiken Auswirkung auf Ihre Arbeit?
HÜLLER Ich versuche, Kritiken nicht zu lesen, es sei denn, jemand rät mir, das bei einem bestimmten Text unbedingt zu tun. Generell interessiert mich eine Kritik mehr, wenn ich weiß, dass meine Arbeit danebengegangen ist – einfach um zu erfahren, was ich verpasst habe, was ich am Drehbuch vielleicht falsch verstanden habe oder an der Regie oder an der Figur. Bei einer Arbeit, bei der ich das Gefühl habe, dass ich das transportiert habe, was ich transportieren wollte, brauche ich dafür keine Bestätigung – aber ich freue mich natürlich, wenn es den Leuten gefällt und gut darüber geschrieben wird.
„Toni Erdmann“ wurde 2016 zum Phänomen. Der Film lief in Cannes, gewann unter anderem den Europäischen Filmpreis, wurde für den Oscar nominiert und auch ein Hit in den deutschen Kinos. Konnte man so etwas ahnen?
HÜLLER Nein, beim Dreh war uns das überhaupt nicht klar. Wir wussten zwar, dass wir eine ungewöhnliche Arbeit machen, und ich kannte die vorigen Filme von Maren Ade, die in kein gängiges Schema passen. Aber was der Film auslösen würde – ehrlicherweise auch bei mir – war uns nicht klar. Erst als ich den Film gesehen habe, wurde mir auch bewusst, welche Reise meine Figur gemacht hat.
Interview über Loriot
Hat sich dieser unerwartete Erfolg irgendwann surreal angefühlt?
HÜLLER Das nun nicht, es ist einfach schön, wenn sich harte Arbeit lohnt. Und durch den Film waren wir viel unterwegs, haben viel erlebt und konnten viele Menschen treffen. Das war ein großes Geschenk für mich – und auch ein großer Rausch. Ich habe etwas Zeit gebraucht, wieder in der anderen Realität anzukommen – es gibt ja mehrere.
Ihre Karriere ist sehr reichhaltig, Sie drehen nationale und internationale Kinofilme, spielen Theater. Wie sehr kann man das planen und eine Karriere steuern?
HÜLLER Ich bin eine unglaublich schlechte Strategin, das merke ich auch zuhause bei Strategiespielen, das funktioniert nicht. Ich kann mir nur vornehmen, mich selbst nicht anzulügen, nicht falschen Anreizen hinterherzurennen und nur das zu tun, was mich interessiert. Oder ich probiere etwas aus, was ich noch nicht gemacht habe, auch wenn es mich nicht unbedingt berührt – einfach damit der Körper und das Gehirn in Bewegung bleiben.
Erklärt das auch, dass Sie neben Hauptrollen gerne auch Nebenrollen spielen?
HÜLLER Es gibt Phasen, da spiele ich Hauptrollen, da brauche ich das – auch finanziell, ehrlich gesagt. Und dann gibt es Zeiten, wo ich mehr zuhause sein möchte, weil ich das Gefühl habe, gefehlt zu haben, und mehr präsent sein möchte. Dann sind das kleinere oder kürzere Sachen, oder Arbeiten näher am Wohnort – das ist sehr unterschiedlich.
Kritik zu „Die Theorie von allem“
Im Film „Alle reden übers Wetter“ haben Sie überraschend einen winzigen Auftritt – wie kam es dazu?
HÜLLER Die Regisseurin Annika Pinske kenne ich schon seit zwölf, 13 Jahren, wir waren Nachbarinnen in Berlin. Da war klar, dass ich bei ihrem Debüt mitspiele, auch wenn sie mich nicht groß besetzt. Das war eine abgemachte Sache, ein Drehtag, der Spaß gemacht hat.
Ist es auch erleichternd, dass man den Film nicht tragen muss?
HÜLLER Das schon – die anderen haben wahnsinnig viel zu tun, und man selbst schaut mal kurz vorbei. Andererseits genieße ich es schon sehr, wenn ich über einen längeren Zeitraum die ganzen Bewegungen der Geschichte mitspüren und mitgestalten darf. Das hat alles Vor- und Nachteile.
Nach „Toni Erdmann“ haben Sie „Fack ju Göthe 3“ gedreht – vom Arthouse-Kino zu einem Mainstream-Jux. Eine ziemliche Überraschung.
HÜLLER Für mich war das ein wichtiger Ausflug in ein anderes Genre, weil ich wissen wollte, wie das funktioniert. Man kann über solche Filme ja alles Mögliche denken – aber wenn man noch nie da war, weiß man nicht, ob man das kann, ob es Spaß macht und ob es vielleicht sogar ein Karriereweg wäre. Das war kurz nach „Toni Erdmann“, wo ich mir nicht sicher war, wie es jetzt weiter geht. Und wenn ich das nicht weiß, dann mache ich eben verschiedene Dinge, bis ich es wieder weiß. Das ist bei mir ein ganz normaler Weg.
Und wie ist Ihr Fazit?
HÜLLER Man soll niemals nie sagen, aber ich glaube nicht, dass mein Daueraufenthalt in diesem Genre sein wird. Ich habe gemerkt, dass ich das wirklich nicht gut kann. Ich war sehr befangen. Solche Filme schaue ich gerne, aber ich kann es leider nicht gut.
Was schauen Sie sich im Kino an – vor allem Arthouse-Filme?
HÜLLER Nein, ich schaue das, was in Kritiken interessant beschrieben wird. Ich war in letzter Zeit sehr oft im Kino, auch weil ich will, dass es die Kinos weiter gibt. Es wird viel über deren Probleme gesprochen und geschrieben, es gibt eine Kampagne mit dem passenden Titel „Das Kino braucht nicht Dich – Du brauchst das Kino“. Wir brauchen solche Orte, an denen wir in Ruhe Filme sehen und über sie nachdenken können – oder zumindest auch einmal entfliehen für eine Weile. Im Kino ist es anders als vor dem Fernseher auf der Couch, wo man dran denkt, dass man gleich noch die Wäsche zusammenlegen muss. In diesem dunklen Ort Kino wird man in die Geschichte hineingezogen.
Sie lesen auch viele Hörbücher ein – ist das auch eine Chance, mehr Kontrolle zu haben als Teil eines Films oder einer Inszenierung mit vielen anderen Menschen zusammen?
HÜLLER Darum geht es mir weniger, ich mag vor allem den Rausch, der bei dieser Arbeit entsteht. Das lange Lesen macht etwas ganz Besonderes mit dem Gehirn, ich mag es sehr, in die Geschichte tief einzutauchen. Einem Text so absolut zu dienen, macht großen Spaß. Und ich bin eine schnelle Hörbuch-Einleserin.
Interview mit Schriftsteller Thomas Hettche
Sie nehmen auch Musik auf – wie kam es dazu?
HÜLLER Musik war bei mir immer da. Ich hatte einen Kassettenrecorder, mit dem ich nachts Musik vom Radio aufgenommen habe. Ich habe gewartet und gehofft, dass der Moderator nicht reinquatscht, habe Mixtapes zusammengestellt – das haben wir ja alle getan. Als Musik noch nicht so frei verfügbar war wie heute, habe ich viel Zeit in großen Drogerieketten mit Musikabteilungen verbracht und neue CDs durchgehört, die in Zeitschriften empfohlen wurden. Ich finde Musik als Ausdrucksform wunderbar, ich lerne auch gerade Klavierspielen, um mehr über die Entstehung von Musik zu lernen – damit das Ganze nicht nur intuitiv bleibt.
Wie haben Sie die Corona-Zeit erlebt und überstanden?
HÜLLER Erstmal hatte ich das Glück, dass ich mich finanziell über Wasser halten konnte. Ich habe es genossen, im Lockdown mit der Familie zusammen zu sein. Zuhause gab es klare Strukturen, Stundenpläne, die den Tag gliedern, damit man nicht abstürzt in ein Nichtstun, in eine Bedeutungslosigkeit. Aber die Erschöpfung, die das alles mit sich gebracht hat, die habe ich erst gespürt, als alles wieder halbwegs normal lief. Da habe ich erst gemerkt, wie viel einem das abverlangt hat, dem Kind gegenüber den Kopf oben zu halten und Mut zu machen, optimistisch zu bleiben. Es gab viele Schulausfälle, es gab viel Ungewissheit und viele Ängste, denen man begegnen musste. Es tut dann gut, einfach Vertrauen zu haben, dass es wieder besser wird – und das hat ganz gut funktioniert.

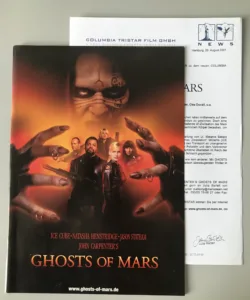










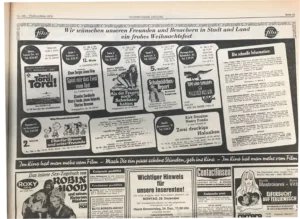

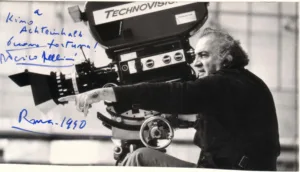



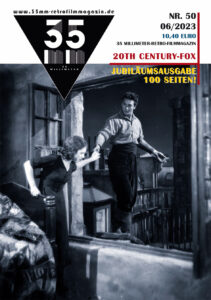



Neueste Kommentare